Geschlechtsverkehr und Musik
Die Grundthese dabei ist erst einmal nicht neu. Musik hat viel mit Geschlechtsverkehr zu tun. Ganz egal, ob man Musik zur Beschallung des Schäferstündchens benutzt oder ob Musik im Kontext des sogenannten „Ausgehens“ dazu beiträgt, etwaige Hemmungen und Hürden zu überwinden und zur allgemeinen Euphorisierung beizutragen. Wer sich außerdem wild hüpfend auf der Tanzfläche zu elektronischer Tanzmusik einigermaßen ansehnlich bewegt, steigert zweifellos die Wahrscheinlichkeit, an diesem Abend nicht frustriert alleine nach Hause gehen zu müssen.
Aber noch etwas ist evident, und damit kommt man von der Rezeptions- zur Produktionsseite von Musik: Die Abwesenheit von Geschlechtsverkehr oder sonstigen sexuellen Kontakten kann dazu beitragen, dass verstärkt Musik produziert wird. Wer seine Zeit nicht mit allzu vielen Sex-Partnern verbringt, hat mehr Zeit um Musik zu machen. Wer seine Energien nicht beim Geschlechtsverkehr verschwendet, hat mehr Energie und Kreativität, die er in seine Musik investieren kann.
„Maskharat“: Pornographisch, laut, gut
Dazu passt es hervorragend, dass mir an der Bar erzählt wurde, dass ein Act aus einem Umfeld in Spanien komme, wo man „Harsh-Noise“ auf der Bühne mache und sich dazu der körperlichen Liebe hingebe. Man könnte sich möglicherweise romantischere Musik vorstellen, passendere aber kaum.
„Harsh-Noise“ ist Sex pur, Pornographie in seiner reinsten Ausprägung. Diese Musik verheimlicht nichts, hält sich nicht mit Vorspiel und schönen Worten auf, sondern geht zur Sache. Laut, direkt, mit einem klaren Ziel. Mehr ist mehr. Wer länger kann und härter zur Sache geht, ist der König dieser Disziplin.
So wurde aus dem Abend ein Lehrstück in Sachen gelebter und unterdrückter Sexualität. Wer hat wann mit wem und warum doch nicht? Was hat das alles mit Musik zu tun? Wer hätte sich lieber dem einen oder anderen Schäferstündchen widmen sollen anstatt Musik zu machen?
Bereits mit „She Destroys Hope“ wurde deutlich, woher der Wind weht. Sie ist schuld, hat Hoffnung und das eigene Leben zerstört. Nur konsequent, dass das mit wütender, viel zu lauter und hochgradig aggressiver Musik quittiert wird. Der Mann von Heute schlägt keine Frauen mehr, sondern vermöbelt mehr oder weniger kunstvoll seine Equipment. Subtilität gibt es anderswo. Es wird mit dem Hammer zu Werke geschritten. Dazu geht der Mann wütend schreiend durch das Publikum, pöbelt Menschen an und trägt dazu bei, dass Biere verschüttet werden.

Mit „Kreuz 17“ wird darauf folgend, laut Selbstbeschreibung, „War Noise“ geboten. Dieser ist primär laut, durchaus mit interessanten Sounds durchzogen und vor allem eine sehr kathartische Angelegenheit. Auch hier gilt: Kürzer und lauter ist besser als länger und differenzierter. „War Noise“ neigt offenbar zur fortwährenden, sich stetig steigernden Klimax und dazu, Wut und Hass ganz ungeschönt auszuspucken.
Mit „Crocanti“ steht danach der Mann auf der Bühne, der für die Kombination von Geschlechtsverkehr und „Harsh-Noise“ steht. Interessanterweise bot er dennoch das bis dahin abwechslungsreichste Set. Enthemmte, sich körperlich liebende Menschen wurden nicht gesichtet. Vermutlich auch deshalb, weil der Frauenanteil an diesem Abend nicht allzu hoch war.
Der anschließende Act „praying + for + oblivion“ machte es kurz: Überfordert von seinem Equipment oder schlicht zu betrunken um seinen Gerätschaften noch Lärm zu entlocken endete sein Set nach wenigen Minuten. Definitiv auch ein Statement. Möglicherweise hatte er hinter der Bühne, siehe Eingangsstatement, bereits etwas Besseres vor.
Mit weiblichen Reizen wollte später hingegen der einzige weibliche Act des Abends nicht geizen. „She spread sorrow“. Definitiv nicht zu verwechseln mit dem ersten Act, der auf den Namen „She Destroys Hope“. Thematisch möglicherweise verwandt, wurde musikalisch ganz anders zu Tat geschritten.
Weiblicher, lasziver, hintergründiger. Ganz in schwarz gekleidet hauchte eine nicht unansehnliche junge Frau ins Mikrofon, schraubte an ihren Gerätschaften herum und ließ die Sache sehr langsam angehen. Wurde hier musikalisch das vorenthaltene „Vorspiel“ nachgeholt oder befand man sich hier schon in der „Chill-Out-Area“ in einem Zustand nach dem Höhepunkt? Man weiß es nicht so Recht. Schön war das allemal. Und eine Erholung für die von den vorangegangenen Acts geschundenen Ohren.
Eine Enttäuschung blieb aber nach diesem Abend zurück: Bei so viel Aggression, Hass und Verzweiflung in der Musik der Acts blieb kaum Zeit für Zärtlichkeit. Auch die These, dass Frauen nicht besonders stimuliert auf „weißes Rauschen“ und „Harsh-Noise“ reagieren darf aufgestellt werden. Das ist ein Problem. Möglicherweise aber auch gut für die Szene, dann aus der Abwesenheit von Geschlechtsverkehr entsteht wiederum Musik und Hass, der sich dann bestens bei einem folgenden „Noise-Festival“ unters Publikum bringen lässt. Der ewige Kreislauf quasi.
Zum Reinhören
Titelbild: Groucho J Grabowski


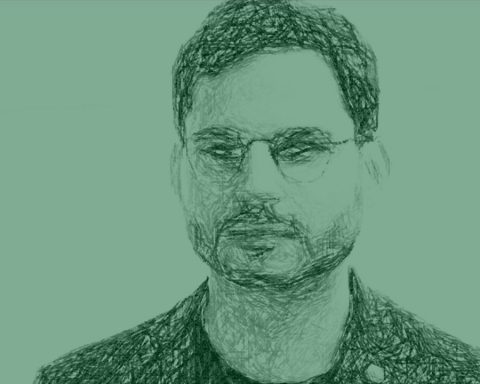

Das hört sich ja alles schwer nach Freud’scher Sublimierungstheorie an. Fehlt es an Sex, so bricht sich die Libido eben im künstlerischen oder wissenschaftlichen Schaffen Bahn. Abgesehen davon, dass ich im Zusammenhang mit Noise, wenn schon, dann eher von ENTsublimierung sprechen würde, war Sartre diesbezüglich ohnehin anderer Meinung:
„Es liegt keine Sublimierung vor, weil das, was die Künstler wollen, eben das ist, was sie tun, nichts weiter: sie begehren den Gegenstand, den sie schaffen, nicht sexuell, sondern als von ihnen in dieser Weise zu schaffenden.“
Jean-Paul Sartre, ›Die Kunst denken‹, Gespräch mit Michel Sicard (in: ›Die Suche nach dem Absoluten. Texte zur bildenden Kunst‹, Reinbek bei Hamburg 1999, S. 139)