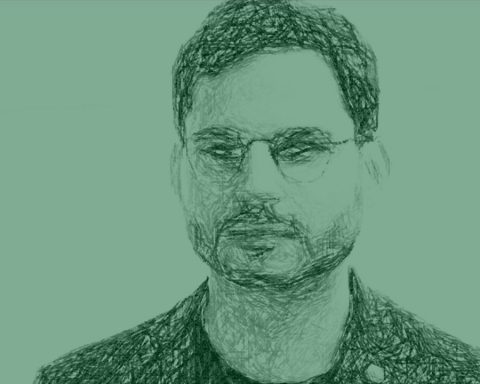Anhand ein paar weniger Beispiele soll dargestellt werden, was Armut vor nicht allzu langer Zeit für Menschen, insbesondere für alleinstehende ältere Dorfbewohnerinnen, bedeuten konnte. Die Schicksale von 2 Frauen aus Inzing führen uns vor Augen, über welch großartigen Netzwerke der sozialen Absicherung wir heute verfügen und wie gut es uns auch in den derzeitigen Krisenzeiten geht.
Die Natesin und die Judith
Das Leben der Natesin (vermutlich ein Hausname, ihr Vorname war Anna) als alte Frau nach dem Ersten Weltkrieg war sehr hart. Erzählt von ihr und Judith hat mir Maria Oberthanner (1918 – 2008), die beide Frauen noch als Kind persönlich erlebt hatte.
Durch die Vermurungen in Inzing (unser Dorf liegt auf einem Murkegel) lagen die ehemaligen Erdgeschoße mancher Häuser unter Niveau und man konnte durch die nun auf Straßenhöhe liegenden Fenster in die Räume hinterblicken. Maria erinnerte sich: „Wir sind immer zu den Fenstern der Natesin schauen gegangen, das hat uns Kinder interessiert, wie sie ihr Süppl auf dem Holzherd gekocht hat. Sie hat keine Rente gehabt, früher haben die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg noch keine gehabt, es sind ja alle arm gewesen, das ist nicht mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Die Natesin hat halt ihr Leben selbst in die Hand nehmen müssen mit „Dachtlen“ (Dochte) machen für die Öllichter. Dazu gab man Wasser in ein kleines Glas, darauf kam dann Öl mit dem Docht und das Licht hat dann solange gebrannt, bis das Öl verbraucht war. Sie hat die Dochte gemacht, die Leute haben diese notwendig gebraucht, weil Kerzen noch teurer und das Öllicht sicher waren. Sie musste wahrscheinlich tausend Dochte oder mehr machen und ging dann in die ganzen umliegenden Dörfer und Bergdörfer verkaufen, damit sie ein bisschen etwas gehabt hat, vielleicht wurde ihr noch etwas geschenkt oder zu essen (mit)gegeben und so hat sie halt ihr Leben gefristet. „Reiser“ (feine, trockene Äste) holte sie vom Berg herunter, mit denen hat sie dann angefeuert und sich in ihrer Rauchkuchl (wahrscheinlich Koch- und Wohnraum, Anm.) eine Brennsuppe gekocht oder das, was ihr andere Menschen geschenkt hatten. In ganzen Scharen sind wir Kinder bei ihrem Fenster gestanden und haben kaum etwas gesehen, weil soviel Rauch, auch von ihrer Pfeife, und Ruß im Raum da unten waren. Manchesmal schimpfte sie mit uns, wenn wir bei ihr hineinschauten: „Macht’s enk durch!“ Und je mehr sie schimpfte, umso eher zog sie uns Kinder an. Ich glaube, dass sie kein Wasser im Haus hatte, neben dem Gebäude, in dem viele arme Menschen lebten, rann der Mühlbach, ein eigenes Klo hatte sie sowieso nicht. Kanalisierung im Dorf gab es zu dieser Zeit keine, an einer dem Haus nahegelegenen Gartenmauer stand ein Plumpsklo aus Brettern, in das es im Winter bei den „Klussn“ hereinschneite. So fristete die Natesin ihr karges Leben. Zu einem späteren Zeitpunkt kam sie dann ins Inzinger Altersheim (damals „Armenhaus“ genannt) und verbrachte dort ihre letzten Tage.“
Maria erzählt von Judith: „Und noch so ein „Weibele“ war die Judith, sie wohnte in einem sehr kleinen Häuschen – eigentlich war es ein umgebauter Stall ohne elektrisches Licht – in der Nähe der Kirche. Versorgt nur von ein paar Geißlein, vielleicht zwei Schafen und selbst gezogenem Gemüse, baute sie sich sogar den Tabak in ihrem kleinen Gartl selbst an. In den Zwanziger Jahren mussten wir Kinder immer für die Männer „ a Röllela Tschigg und a Packel Tabak“ von einem kleinen Geschäft holen gehen. Das Haus der Judith lag direkt an einem schmalen Steig auf dem Weg dorthin: An der Judith ihrem Küchenfenster stehenbleiben, dunkel war es je nach Jahreszeit auch schon oft und man konnte ins erhellte Küchenfenster bei ihr hineinschauen. Ich konnte sehen, wie sie anfeuert und es war alles voller Rauch, sie war Pfeifenraucherin und hat, wie gesagt, in ihrem Gartl richtige Tabakpflanzen gehabt. Die Blätter wurden im Sommer an Fäden zum Trocknen aufgehängt. Geraucht hat sie, dass richtige Glutnester aufgeflogen sind. Öfters hat uns die Mutter ein Ei oder etwas anderes für die Judith mitgegeben: „Muatter, gib ins halt eppes mit für die Judith, nachher derf’n wir wieder Geißlein schaug’n“ – wenn es zu Ostern kleine Zicklein gab. In Judiths Stallele gab es natürlich kein elektrisches Licht, nur ein Öllichtl hat sie mitgehabt, dann durften wir schauen, wie die Geißlein von der großen Geiß Milch tranken. Wenn die Judith beim Melken war, ließ sie uns auch kosten, wir haben daheim genug Milch gehabt, aber keine Geißmilch. Die Judith ging immer das an den Straßenrändern wachsende Gras mit der Sichel schneiden und hat das Zusammengesammelte rund um ihr kleines Haus „augschtanggert“ (Heumandln gemacht, Anm.). Mit diesem Heu hat sie dann die Geißlein gefüttert. Das war ihr Leben, vermutlich wird sie als junger Mensch ins Tagwerk (als Magd) gegangen sein. Versichert ist damals niemand gewesen, so dass man vielleicht mit einer Rente hätte rechnen können. Es war für alte Menschen eine Katastrophe. Man war oft auf kleine Geschenke wohlgesonnener Dorfbewohner angewiesen und durfte nicht heikel sein, wenn man kaum ein Stückchen Brot hatte. Ihr Haus gab die Judith dann einer jungen Frau, die sie bis zu ihrem Lebensende gut pflegte.“
Quelle: Dorfzeitung Inzing 3/99