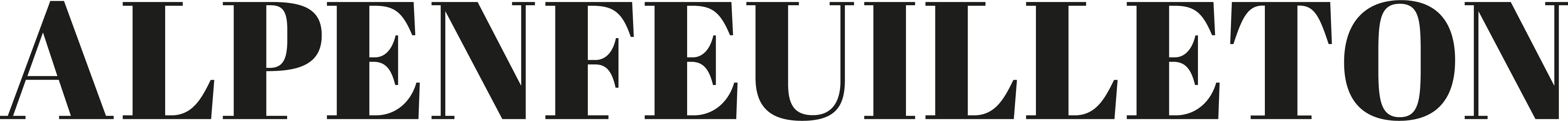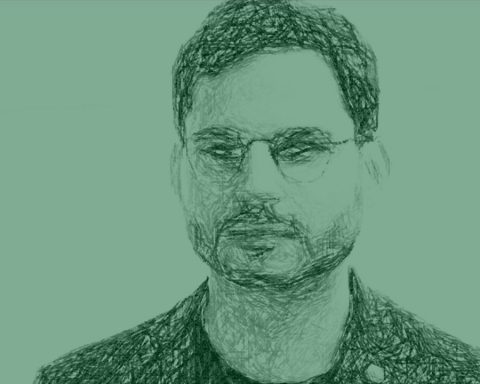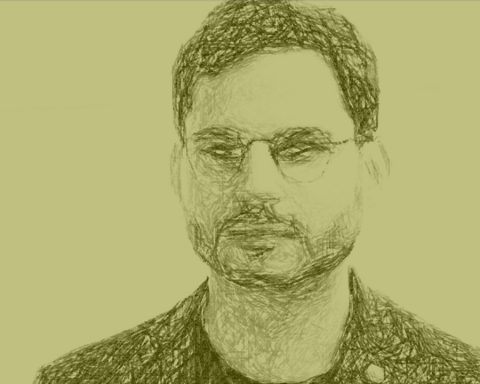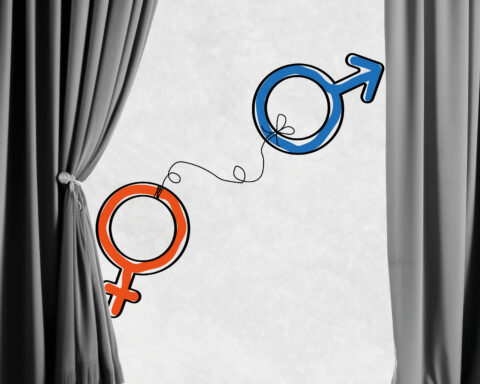Was haben die derzeit grassierende Pandemie und Kriege gemeinsam? Beide kosten tausenden Menschen das Leben.
Wo aber sind die Unterschiede? Zum einen in ihren Ursachen, zum anderen in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch wenn der Anfang der Corona-Verbreitung noch nicht endgültig geklärt ist, steht doch immerhin fest, dass die Übertragung des Virus auf den Menschen – wie auch bei allen früheren Seuchen – nicht mit Absicht erfolgte.
Ganz anders bei den Kriegen. Sie liegen fast durchwegs im Machtstreben und Geltungsdrang einzelner oder mehrerer Herrscher begründet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dem bislang größten Verbrechen an der Menschheit mit über 50 Millionen Toten, sind die Eroberungskriege, die frühere Jahrhunderte füllten, seltener geworden. Sie wurden von sogenannten „Bürgerkriegen“ zwischen diktatorischen Herrschern und der Opposition oder zwischen verschiedenen Gruppen einer Gesellschaft, wie zuletzt etwa in Syrien, abgelöst.
Wenn sich daraus vielleicht die Hoffnung auf ein Ende der traditionellen Eroberungskriege ableiten lässt, besteht in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer ein großer Nachholbedarf. Während die Seuchen in den Geschichtsbüchern durchwegs als Geißel dargestellt werden, die unterschiedlich viele Menschen dahinrafften, muss das von Kriegen verursachte Leid in den Geschichtsbüchern fast mit der Lupe gesucht werden.
Stattdessen werden die für die Kriege Verantwortlichen bis heute als „Helden“ angeführt und mit positiv besetzten Beinamen wie Alexander der Große, Karl der Große oder der große Franzose Napoleon versehen. Wie viel Leid der Verlust eines Sohnes oder Ehemannes, eines Vaters oder Bruders über deren Angehörige brachte, wird in den Geschichtsbüchern kaum thematisiert. Hinweise auf den „Sachsenschlächter“ Karl den Großen oder die Verheerungen des 30-jährigen Krieges finden sich nur selten. Ein aus dieser Sicht längst fälliges Umschreiben der Geschichtsbücher ist noch nicht absehbar, wäre aber hoch an der Zeit.
Vielleicht könnten die in den letzten Wochen vom Sockel der Verehrung gestoßenen Sklavenhalter auch dazu einen Anlass geben. Wozu sollen Generationen von Schülerinnen und Schülern die Namen von Herrschern lernen, die um den Preis zahlloser Menschenleben und lediglich zur Mehrung ihres eigenen Egos – wie man heute sagen würde – ihre Reiche vergrößert haben? Und wenn sie schon Erwähnung finden sollen, dann nicht als Helden, sondern als hoffentlich abschreckende Kriegstreiber und „Massenmörder“.
Gleichzeitig könnten die wenigen Herrscher, die das Leben ihrer Bevölkerungen tatsächlich verbessert haben, stärker in den Vordergrund gerückt und ihre Taten breiter ausgeführt werden? Sieht aus wie eine Mammutaufgabe, wäre aber gerade für jüngere Historikerinnen und Historiker der Mühe wert.