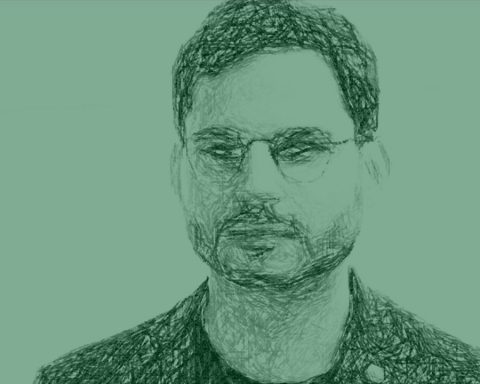Wer in den Orden eintritt, akzeptiert die strengen Regeln, zu denen neben dem täglichen Gebet, auch Schweigen und Freiheitsentzug gehören. Für Sophia war das nie ein Problem gewesen. Im Gegenteil. Sie war in jungen Jahren zum Orden gestoßen und hatte hier zum ersten Mal Frieden gefunden. Für sie war das Kloster ein Zufluchtsort. Weg von den Eltern, weg von den ständigen Umzügen und den Erwartungen.
Im Kloster gibt es feste Regeln, feste Abläufe und vor allem hat jede von ihnen ihren Platz. Jede ist ein Teil des Ganzen. Eine unter Gleichen. Das war es, das Sophia von Anfang an fasziniert hatte. Die Sicherheit und die Beständigkeit. Hier lauerten keine bösen Überraschungen, keine unerwarteten Ereignisse. Im Kloster sind die Tage vorhersehbar, selbst die Wochen und Monate. Für diese Sicherheit war Sophia bereit alles aufzugeben, selbst ihre persönliche Freiheit.
Im Orden ist es, außer der Oberin, keiner Schwester erlaubt das Klostergelände zu verlassen. Wer in dieses Kloster eintritt, führt ein streng klausuriertes und kontemplatives Leben. Mit einer Ausnahme. An einem Tag im Jahr, am Faschingsdienstag, steht es jedem Ordensmitglied frei, durch den steinernen Bogen zu treten und das Klosterleben für 24 Stunden hinter sich zu lassen. Dieser Brauch existiert seit Jahrhunderten und sollte es den Nonnen erlauben ihre Familien wenigstens einmal im Jahr zu sehen. Doch noch viel wichtiger war schon immer die Wirkung, die ein solcher Schritt in die Freiheit, auf die Ordensschwestern hatte. Er soll sie immer wieder aufs Neue daran erinnern, welch gutes Leben der Schutz des Ordens ihnen ermöglicht. Ganz im Gegensatz zu dem sündigen Treiben in der Außenwelt.
Sophia hatte in den letzten zehn Jahren immer auf diese Möglichkeit verzichtet. Doch heute war sie fest entschlossen den steinernen Bogen hinter sich zu lassen.
Szene 1
Es war ein schöner Tag. In der Nacht zuvor hatte ich keine Sekunde lang geschlafen. Als ich nach dem gemeinsamen Frühstück wieder auf mein Zimmer gegangen bin, fielen schon die ersten Sonnenstrahlen durch die kleine Luke im Dach. Sie haben mein Zimmer in dieses gelbe, warme Licht getaucht, das die erste Frühlingssonne mit sich bringt. Der Winter schien vorbei zu sein. Und das, obwohl wir erst Anfang Februar hatten. Es war fast so, als wollte mich die Natur willkommen heißen, mir sagen, dass alles gut werden würde und ich keine Angst haben müsse.
Zehn Jahre war ich nicht mehr draußen. Ein beklemmendes Gefühl stieg damals in mir hoch, als ich mir die Bilder ausmalte und darüber nachdachte, wie Stadt wohl aussehen würde? Würde ich sie wiedererkennen? Hatte sie sich sehr verändert? Und wie würden die Menschen heute aussehen? Im Kloster gibt es keinen Fernseher und der einzige Computer wird ausschließlich von der Oberin und ihrer Assistentin bedient. Die einzigen Menschen von außen, die wir normalen Ordensschwestern zu Gesicht bekamen, waren die Lieferanten, die uns die wenigen Lebensmittel, die wir nicht selbst angebaut hatten, zum Hintereingang brachten, der Postbote und die Leute auf den Bildern der Regionalzeitung.
Diejenigen von uns, die den Familientag nutzten und für einen Tag lang das Kloster verließen, wussten kaum etwas über die Außenwelt zu berichten. Die meisten wurden direkt von ihren Familien abgeholt, fuhren entweder, sofern innerhalb eines halben Tages erreichbar, direkt nach Hause oder in ein Gasthaus aufs Land. Die Freude darüber die Liebsten wieder zu sehen, fesselte ihre ganze Aufmerksamkeit, so dass sie den Blick für ihre Umgebung komplett verloren. Einmal wollte ich wissen, ob es den kleinen Bäcker neben der alten Schule noch gab. Doch niemand hatte darauf geachtet.
Es war die Mischung aus Neugier und schlechtem Gewissen, die mich an diesem Tag aus dem Kloster trieb. Ich wollte die unzähligen Fragen, die sich über die Jahre in meinem Kopf gesammelt hatten, endlich beantwortet wissen. Und obwohl ich erst zwei Jahre vor meinem Eintritt ins Kloster in die Stadt gezogen war und meine Familie längst nicht mehr dort lebte, hatte ich trotzdem ein paar wenige Freunde, die ich nun zehn Jahre nicht mehr gesehen hatte. Mit meiner Banknachbarin aus der Schule schrieb ich ab und zu Briefe. Aber immer, wenn sie mich nach einem möglichen Treffen fragte, bin ich ihr ausgewichen.
Nun hatte ich mich mit ihr und ihrem Lebensgefährten verabredet. Wir wollten uns am Hauptplatz treffen. Bei der Straßenbahnhaltestation. Von dort aus wollten wir durch die Fußgängerzone schlendern und dem närrischen Treiben ein wenig zusehen.
Szene 2
Maya,
es tut mir leid.
Ich habe das alles so nicht gewollt. Du weißt, dass der Faschingsdienstag bei uns Jungs große Tradition hat. Jedes Jahr treffen wir uns und gehen in die Stadt. Das ganze Team ist mit dabei, auch der Trainer. In diesem Jahr war die Stimmung einfach eine andere. Das hat schon in der Arbeit begonnen. Ich musste zwanzig Minuten auf meinen Chef einreden, bis er eingesehen hat, dass er die Bude zusperren soll. Aber wie sollen sich fünf Mitarbeiter auf die Arbeit konzentrieren, wenn sie im Kopf eigentlich ganz wo anders sind?
Wir haben uns dann alle am Hauptplatz getroffen. Gleich hinter der Straßenbahnhaltestation. Ich bin etwas zu spät gekommen, weil mein Chef noch etwas wollte. Die Jungs waren schon da und einige hatten richtig gut getankt. Vor allem Patrick. Aber du kennst ihn ja. Er ist normalerweise echt ein total ein Lieber, das weißt du. Er ist der perfekte Schwiegersohn. Ruhig, sauberes Aussehen, drückt sich gewählt aus und ist vor Frauen immer ein wenig ehrfürchtig.
Diesmal war er ganz anders. So kenne ich ihn gar nicht. Er hat schon bei meiner Ankunft kaum gerade stehen können, hat irgendetwas von Sandra erzählt und dass sie ihm gestohlen bleiben kann. „Die Weiber kannst du doch alle vergessen. Schau sie dir nur an“, hat er dauernd gebrüllt. Die anderen fanden es lustig. Mir hat er leid getan. Nach meiner Ankunft ging alles recht schnell. Eine Runde hier, eine Runde da. Ein Bier nach dem anderen. Ich bin da nicht ausgekommen. Dauernd hat jemand etwas gezahlt. Der letzte Becher war noch nicht einmal halb leer, da war der nächste volle schon da.
Irgendwann wurde es uns dann zu kalt. Der Wind ging ja wie verrückt. Wir haben uns dann entschieden in das Gasthaus am Stiftsplatz zu gehen. In die Keller-Bierbar, in der wir zum Geburtstag deines Vaters waren. Der Trainer hat eine Runde Maß bestellt. Klar ging es darum, wer sie am schnellsten wegtrinkt. Danach weiß ich nicht mehr viel. Ich kann mich nur an die zwei Frauen am anderen Ende der Bar erinnern. Irgendein Typ stand noch dabei glaube ich. Patrick hat dauernd etwas zu ihnen rübergebrüllt.
Die eine war als Indianerin verkleidet und die andere als Nonne. Aber so richtig. Nicht wie eine sexy Schwester, sondern richtig prüde. Patrick hat das so aufgeregt, dass er irgendwann zu ihr rüber ist. Vorher hat noch genuschelt, dass genau die Prüden es doch am meisten wollen. Die, die sich zieren und so tun als wären sie etwas Besseres, dabei seien alle nur gleich. Er ist dann zu ihnen rüber und hat der Nonne an den Arsch gefasst. Zwei Jungs sind mit und haben sich um ihre Freundin gekümmert. Als der Typ, der bei ihnen stand dazwischen gehen wollte, haben sie ihm eine gegeben. Ich bin dann auch rüber und ab dem Zeitpunkt weiß ich nur noch, dass mich etwas Hartes am Kopf getroffen hat.
Meine nächsten Erinnerungen sind dann von der Polizeidienststelle. Wie ich hier aufwache und die Sanitäter sich um meine Wunde kümmern. Zwei Polizisten haben schon auf mich gewartet und wollten mir einige Frage stellen. Sie meinten ich habe eine Klosterfrau sexuell belästigt und ihren Begleiter tätlich angriffen. Dabei war ich das gar nicht. Ich bin nur daneben gestanden und wollte dann zur Hilfe eilen. Die Jungs haben sie einfach gehen lassen. Sogar Patrick. Nur weil der so unschuldig aussieht. Mich haben sie hier behalten.
Maya. Ich weiß du willst mich nicht sehen. Aber ich bitte dich, antworte mir. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Aber ich bin unschuldig. Es war dieser verdammte Faschingsdienstag, dieser Ausnahmezustand. Alle waren betrunken und haben sich daneben benommen. Aber ich bin unschuldig. Ich habe niemandem etwas getan. Maya. Es tut mir leid. Bitte rede doch mit mir. Ich bin wieder ich, versprochen.
In Liebe,
dein Stefan.
Szene 3
Der Faschingsdienstag hat in unserem Kloster eine große Bedeutung. Es ist nicht nur der Tag an dem die Schwestern ihre Familien sehen können, sondern ein Tag der Wichtigkeit unseres Ordens untermauert. Wenn die Ordensmitglieder in die Außenwelt treten, sind sie nackt. Obwohl sie das Kloster in ihren gewohnten Kleidern verlassen, sind sie nackt. Denn der Schutz der Gemeinschaft, der Schutz des Hauses fehlt ihnen. Sie sind es gewohnt nach strengen Abläufen zu leben, zu gehorchen und ihre Aufgaben pflichtbewusst zu erfüllen. Sie können sich auf mich, auf die Gemeinschaft und die anderen verlassen. Doch draußen ist das anders. Draußen ist man auf sich alleine gestellt. Auf sich und auf Gott. Der Faschingsdienstag mit all seinen Narren und der Ausgelassenheit ist genau der richtige Tag, um das zu unterschreichen.
Normalerweise kommen die Schwestern geläutert und glücklich von ihrem 24 Stunden Ausflug zurück. Die meisten haben zwar ihre Familien getroffen, aber gespürt, dass sie nicht in die Außenwelt gehören. Sie haben gemerkt, dass die Welt draußen eine andere ist, in der andere Gesetze gelten und Egoismus und Eigensinnigkeit regieren. Doch bei Schwester Sophia war das anders. Sie kam früher als die anderen wieder ins Kloster zurück und wollte mich sofort sehen. Sie war zehn Jahre nicht mehr draußen gewesen und ich war mir sicher, dass ich eine verstörte junge Frau auffinden würde, die Trost suchte. Doch ich hatte mich geirrt.
Mir gegenüber stand eine junge Frau die mich anstrahlte und voller Überzeugung zu sein schien. Nur der große Fleck auf ihrem Habit und die kleinen Risse an der Naht ließen das Bild unecht wirken. Ich fragte sie nach ihrem Befinden. Sie konnte nicht aufhören zu lächeln und meinte wortwörtlich: „Schwester Oberin, es geht mir wunderbar. Es ging mir nie besser.“ Ich hakte nach und wollte Details erfahren, was sie in der Außenwelt erlebt hatte. Woher kamen die Risse und der große Fleck? Doch sie antwortete nur, immer noch mit einem Lächeln auf den Lippen: „Es war erschreckend. Ich habe mich noch nie so erniedrigt gefühlt. Ich habe gesehen wie der Alkohol Männer zu Tieren macht. Ich habe gesehen wie ein Bierkrug auf einem Kopf zerbricht und Blut spritzt.“ Ich konnte meinen Ohren nicht trauen und fragte sie, warum sie dann lächelte, wenn ihr doch so widerwärtige Dinge erfahren seien?
Schwester Sophia wurde ernster. Es war der drittletzte Satz den ich je von ihr hören sollte: „Ja, es war erschreckend, aber ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.“ Schwester Sophia hat danach ihre Kapuze abgenommen, sie mir gegeben und ihren Austritt aus dem Orden verkündet. Als sie in Richtung Holztüre ging, habe ich ihr noch eine Frage nach gerufen. Eine Frage, die mir einfach keine Ruhe lassen wollte: „Wieso? Wieso gerade jetzt, wo du gesehen hast wie die Menschen draußen sind? Dass sie Masken aufsetzen und sich gegenseitig verletzten?“ „Weil wir alle Masken tragen und es an der Zeit ist, dass ich meine endlich ablege.“
Titelbild (c) jill, jellidonut… whatever, break dancing nuns, flickr.com