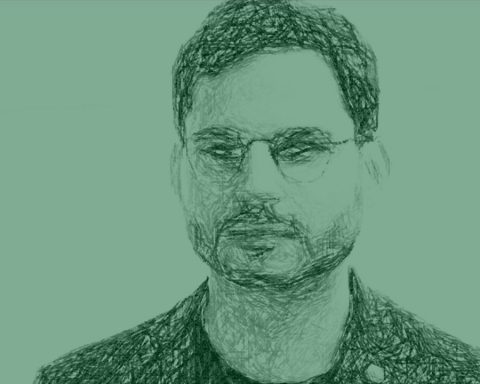Untertitel: Die Bilder des Mannes mit dem geduldigen Blick.
Es ist alles eine Frage der Sichtweise. Dieser Satz wurde mir seit meiner frühen Kindheit stetig eingeprügelt. Meine Eltern, beides gebildete und belesene Menschen mit einer Leidenschaft für bildende Kunst, beteten mir dieses Credo täglich mantraähnlich vor. Während für andere Kinder Gutenachtgeschichten Welten voller fabelhafter Wesen waren, in denen das Gute am Ende immer über das Böse triumphiert, waren die Bösen in den Geschichten, die mir erzählt wurden, immer arme Wesen, die auf Grund eines schicksalhaften Ereignisses zu ihren Taten getrieben wurden. Man konnte sie nicht hassen, man entwickelte Mitgefühl. Selbst die vermeintlich Guten, waren in diesen Geschichten nicht wie gewohnt makellos und unfehlbar, sondern vom Glück begünstigt und allzu sehr auf sich selbst fixiert, was in den Augen meiner Eltern ebenfalls eine Charakterschwäche darstellte, die es tunlichst zu vermeiden galt.
Ich bin alles andere als auf mich selbst fixiert. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich schaue auf all die anderen. Ich bin da und beobachte sie. Ich sitze in der Straßenbahn und schaue, wie sie mit einander reden. Ich stehe in der Ecke und schaue, wie sie tanzen. Ich liege auf der Couch und schaue, wie sie am Fenster vorbeigehen. Ich schlendere durch den Park und schaue, wie sie in der Wiese liegen. Ich spaziere am Fluss entlang und schaue, wie sie die Füße ins Wasser halten. Ich bin ein Mensch, der sich für andere interessiert. Ich schaue genau hin. Ich schaue mir an, wie sich Nasenflügel weiten, wenn sich junge Paare frisch verliebt ansehen. Ich sehe, wie Augenlider nervös zucken, wenn Manager gestresst nach dem Taxi winken. Ich bemerke, wie die Mundwinkel sich verziehen, wenn kleinen Kindern ihr Eis verweigert wird. Ich interessiere mich für die anderen, nicht für mich.
Mein Vater wollte, dass ich viel lese und mit ihm Ausstellungen besuche. Er meinte, das gehöre zu einer anständigen Bildung einfach mit dazu. Wir haben deshalb viele Vater-Sohn-Ausflüge gemacht. An mindestens drei Wochenenden im Monat sind wir gemeinsam in eine Stadt gefahren. Oft nach Holland, oft nach Venedig, manchmal auch nach Tschechien und selten nach Frankreich. Mein Vater war kein Freund der Franzosen. Meine Mutter wollte, dass ich selbst viel male. Sie meinte, das würde mich in meiner Entwicklung schneller weiterbringen. Wir haben deshalb viele Mutter-Sohn-Nachmittage gemacht. An vier oder fünf Tagen in der Woche sind wir gemeinsam hinters Haus in den Schuppen gegangen und haben stundenlang gemalt. Oft abstrakt, oft futuristisch, manchmal auch impressionistisch und selten realistisch. Meine Mutter war keine Freundin des Realistischen.
Das Rot ist eindeutig zu hell. Es müsste dunkler sein, mehr rostig, als blütenrot. Es darf nicht nach Frühling aussehen, eher nach Herbst. Es müssen unterschiedliche Rottöne sein. Kleine helle Spritzer und große dunkle. Es ist wichtig, dass man es nicht nur sieht, man muss es riechen, schmecken, fühlen. Es muss so sein, als wäre man direkt im Bild. Wenn man darauf schaut, muss es einen in seinen Bann ziehen, es muss einen packen, es muss einen in seine Welt ziehen. Das Rosa wirkt zu steril. Es müsste dreckiger sein – mehr fahl, als grell. Es darf nicht nach Plastik aussehen – eher nach Papier. Es müssen unterschiedliche Rosatöne sein. Kleine dunkle Stellen und große helle. Es ist wichtig, dass man nicht nur die Fläche sieht, man muss die Form mitbekommen, sie erkennen, sie wahrnehmen. Es muss so sein, als wäre es ein echter Körper. Wenn man darauf schaut, muss es einen in seinen Bann ziehen, es muss einen packen, es muss einem seine Welt entziehen.
Endlich ist das Kunstwerk fertig. Ich habe vierundvierzig Jahre darauf hingearbeitet. Nun ist es endlich fertig. Es ist vollbracht. Es ist vollständig. Und noch viel schöner, als ich es mir je erträumt habe. Die Perspektive stimmt. Die Formen. Die Farben. Das Licht. Das Motiv. Es wirkt, als hätte jemand den Moment festgehalten, in all seiner Wahrhaftigkeit. In seiner Ganzheit. Ganz so, als hätte man den Augenblick eingefangen, mit einem Kescher und den Inhalt über der Leinwand ausgeschüttet. Ich musste lange hinsehen. Auf jedes kleine Detail, um es so zu malen. Die geweiteten Nasenflügel, die aufgerissenen Augen, die verzerrten Münder. Die stummen Schreie, der trockene Schweiß, der Geruch von offenen Körpern. All das musste ich mir genau ansehen. Drei Tage lang. Ich bin gesessen und habe geschaut. Ich bin gestanden und habe geschaut. Ich bin gelegen und habe geschaut. Ich bin herumgeschlendert und habe geschaut. So lange, bis ich jedes Detail in mir hatte. Bis jedes Teil fest in meinem Kopf war. Bis das Bild endgültig und vollständig in mir war. Bis ich im Bild war.
Sie sind überrascht gewesen, als ich ihnen von meinem Plan erzählt habe. Sie haben mich ausgelacht, als ich ihnen gedroht habe. Sie haben sich gewehrt, als ich sie im Schuppen aneinandergebunden habe. Sie haben geschrien, als ich ihnen die Schaufel über den Kopf gezogen habe. Sie haben geschwiegen, als ich ihnen die Köpfe abgeschnitten habe. Sie haben sich übergeben, als sie ankamen, mit ihrem Blaulicht. Sie haben hinter vorgehaltenen Händen getuschelt, als sie mich gesehen haben. Sie haben mich mitgenommen, als ich mich nicht gewehrt habe. Sie haben mir hunderte Fragen gestellt, als ich im Raum mit der Neonröhre vor ihnen saß. Sie haben mich in eine Zwangsjacke gesteckt, als ich nicht mit ihnen reden wollte. Sie haben mich in eine Einzelzelle gesetzt, als ich für immer geschwiegen habe. Sie haben geglaubt, dass ich es alleine getan habe, als sie mit den Medien gesprochen haben. Sie haben so getan, als wäre ich der Irre, der Menschenleben ausgelöscht hat. Doch. Es ist alles eine Frage der Sichtweise.
SchauergeschichtenDie Schauerliteratur entstand Mitte des 18. Jahrhunderts in England und wird der Phantastik zugeordnet. Sie ist eng verwandt bzw. ein Vorgänger der Horrorliteratur. Eine unserer Missionen ist es, solche Perlen aus der Schatzkiste zu holen und sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. (Abgesehen davon ist das Verfassen von Schauergeschichten die heimliche Leidenschaft unseres Chefredakteurs.) Bald mehr – hier am ALPENFEUILLETON. |