Wagt man einen Vergleich zwischen der Jazzwoche in Burghausen und einigen österreichischen Jazz-Festivals, dann fällt vor allem auf, dass Österreich über eine rege Festival-Landschaft verfügt, was experimentellere „Jazz-Festivals“ betrifft. Diese beschäftigen sich überwiegend mit den „freieren“ und „avantgardistischeren“ Spielformen.
Zeitgleich zur „Jazzwoche Burghausen“ fand etwa das Festival „ArtActs“ in St. Johann in Tirol statt. Hier dockt man, sehr grob gesagt, an „freien Jazz“ sowie an alle damit in Verbindung stehenden avantgardistischen Tendenzen der „freien“ und „improvisierten“ Musik an, die das möglicherweise belastende Label des „Jazz“ bereits abgelegt hat.
Unter dieser freien Improvisation verschwimmen etwaige Genre-Grenzen hin zur sogenannten „Neuen Musik“. Es ist zumeist Musik, die sich so viele Freiheiten nimmt und so sehr mit konventionellen Strukturen und Erwartungshaltungen bricht, dass sie bei einem großen Teil der Hörerinnen und Hörer auf Unverständnis stößt.
Wie auch immer man diese Tatsache bewertet, eines wird bei diesem Festival gut sichtbar: Durch die Grundlagen des Experimentes und durch das Primat der freien Improvisation wurden stillschweigend über die Zeit ästhetische und künstlerische Dogmen geschaffen, die sich darin äußern, dass das „Konventionelle“ und „Bruchlose“ oder gar das Melodiöse und Zugänglich in diesem Kontext kaum Platz findet.
So sehr man diese Musik auch für ihre Abenteuerlust mögen kann: Es ist Musik für Kenner und Eingeweihte, die sich sektiererisch jedes Jahr immer wieder treffen um mit Gleichgesinnten Musik zu hören, die dem Durchschnitts-Hörer als strukturloserer Lärm oder gar Kakophonie erscheint. Das schweißt zusammen, bildet Szenen, bestätigt Hörgewohnheiten und taugt darüber hinaus auch gar nicht schlecht zur Distinktion.
Man verzeihe mir diese Vereinfachung. Aber diese Diagnose gilt für mindestens drei weitere Festivals in Österreich, die auf die Namen „Unlimited“, „Kaleidophon“ und, mit Abstrichen, auf „Jazzfestival Saalfelden“ hören.
Wer sich in den Dogmen der Nicht-Dogmatischen-Musik einrichtet schafft wieder Gefängnisse, wo eigentlich Offenheit sein sollte.
Verlässt man diesen paradoxerweise mit dogmatischen Zügen ausgestatteten Zirkel stößt man unweigerlich auf Festivals in Österreich, die einen anderen Weg gehen. Diese werden von den Mitgliedern des Zirkels der „freien Musik“, die sich fast alle persönlich kennen und sich auf Festivals im deutschsprachigen Raum immer wieder treffen, mit Verachtung oder zumindest Missachtung gestraft. Da wären unter anderem das Festival „Outreach“ in Schwaz zu nennen – oder auch an das „Jazz Fest Wien“ zu denken.
Vor allem letzteres ist verpönt. In diesem Jahr wird auf diesem Festival unter anderem auch Cyndi Lauper spielen. Natürlich neben allerlei Acts, die doch deutlich mehr mit Jazz zu tun haben. Darunter auch eine Band, die im englischsprachigen Raum für einen deutlichen „Coolness-Schub“ verantwortlich ist, was den Jazz betrifft: Snarky Puppy.
Das „Outreach“ wiederum nennt sich hin und wieder „Jazz-Festival“, manchmal aber auch einfach „Music-Festival“. Alles ist Musik. Man muss gar nicht Jazz dazu sagen. Das ist zwar ein löblicher und an sich richtiger Ansatz, dieser verschleiert aber zwangsläufig die Grundlagen des Jazz als improvisierte und wandelbare Musik.
Jazz mag mithin das offenste aller „Systeme“ sein. Doch genau diese Offenheit und diese Grenzenlosigkeit sind es Wert verteidigt zu werden. Indem ich den „Jazz“ nur mehr „Musik“ nenne, gehe ich die Gefahr der Beliebigkeit und der Schwammigkeit ein. Diesen Vorwurf könnte man nicht nur „Outreach“, sondern auch dem „Jazz Fest Wien“ machen, das den Namen „Jazz“ ebenfalls nicht grundlegend für die Programmierung braucht. Sowohl Snarky Puppy als auch Bobby McFerrin als auch Beth Hart würde ohne diesen Kontext ebenso funktionieren.
Die Frage ist somit einfach und provokant zu formulieren: Wie schafft es der Jazz sich zu öffnen, ohne seine grundsätzlich wichtigen ästhetischen Grundlagen zu verlieren und sich in Pop-Kontexte und Beliebigkeit aufzulösen? Wie schaffen es Festivals, sich von den Dogmen des Nicht-Dogmatischen zu lösen und „freie Musik“ mit „kommerzielleren“ Spielarten zu versöhnen. Wie lässt sich somit das volle Spektrum ausschöpfen und die volle Tradition des „Jazz“ anzapfen?
Ich habe keine letztgültige Antwort. Ich sehe nur zwei Tendenzen: Auf der einen Seite verflacht der Jazz, biedert sich an, wird seicht und macht sich als Zuschreibung und als Ästhetik obsolet. Auf der anderen Seite wird er strikt elitär und richtet sich an die Eingeweihten und Wissenden.
Das Problem ist nur: Diese Eingeweihten und Wissenden altern, es gibt so gut wie keinen Nachwuchs. So kann man natürlich zweifellos warten, bis die Rezipienten solche Festivals zu alt werden um quer durch Europa zu reisen und bis dahin auf eine sehr kleine, aber durchaus feine ZWieielgruppe setzen, die ihren Jazz am liebsten frei improvisiert und abenteuerlustig haben möchte.
Man kann als Festivalmacher aber natürlich auch darauf setzen, auf diese experimentellen Spielarten überhaupt zu verzichten. Der Verlust wäre meiner Meinung aber enorm und beklagenswert.
Eine Option wäre ein Festival, das Durchlässigkeiten produziert und Verbindungen zwischen Spielarten herstellt. Ein einschließendes Festival, das aus dem Vollen schöpft und Hörerinnen und Hörer generell einlädt, sich mit den vollen Möglichkeit einer Musikrichtung zu beschäftigen, die man immer noch als „Jazz“ bezeichnen könnte. Ganz einfach, weil mit diesem Begriff Traditionen und eine ellenlange und fruchtbare Musikgeschichte einhergeht.
Jazz ist nicht Pop. Jazz muss aber möglicherweise fragen, warum er nicht mehr populär ist und wie er sich wieder in populäre Diskurse einschleusen könnte. Eine Antwort auf diese Dichotomie zwischen Experimentell und Kommerziell werden Festivalmacher und Veranstalter geben müssen. Sofern sie nicht ihr eigenes Süppchen weiterkochen und darauf warten, bis sich der Jazz endgültig in viele kleine Sub-Genres für kleine Hörer-Minderheiten aufgespalten hat und sich zunehmend für die breitere Masse überflüssig gemacht hat.
Es muss ganz einfach mehr geben als die zwei daraus ableitbaren Optionen. Die Zukunft darf nicht entweder den Untergang oder die künstlerische Irrelevanz bedeuten. Es wäre an der Zeit, die richtigen Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Vor allem von Seiten der Festival-Macher und Veranstalter.
Titelbild: Felix Kozubek

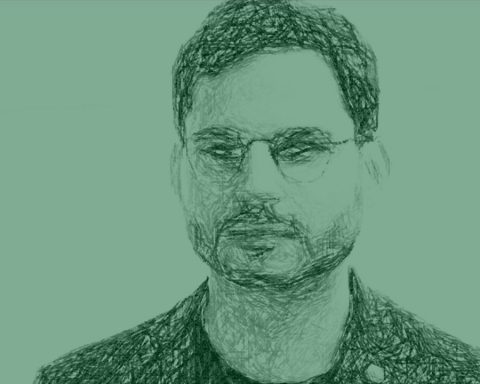


Ein löblicher Aufruf zum Schluss, aber die Zweiteilung erscheint mir doch etwas gezwungen und sie ignoriert die hochinteressanten Versuche etwa der Jazzwerkstatt Wien (+ Jazzwerkstatt Vorarlberg), die sich mal in den Gefilden der Cacophonie herumtreibt und dann wieder mit den Strottern zusammenarbeitet. Oder Clemens Wengers neueste CD Neapel mit Electronik und Streichquartett.
Und ich lese immer wieder mit Ingrimm von Schreibenden unter 40 über das vergreisende Konzertpublikum.
1. Gibt es einfach viel mehr Leute, die zw. 1950 und 1965 geboren sind als in jedem belieben 15-Jahre Zeitraum seither. Get used to it!
2. Waren diese Leute jung, als Beatles, Rolling Stones, Bossa Nova, Stan Getz, Werner Pirchner oder Al Jarreau jung waren (lässt sich beliebig erweitern) und haben nicht nur große gesellschaftliche Umwälzungen, sondern auch erstaunliche neue musikalische Akzente entstehen sehen.
Es könnte also sein, dass das grauhaarige Publikum offener und interessierter ist als man ihm zutraut und das womöglich noch ziemlich lang.
Ganz abgesehen davon, dass diese Generation in den meisten Fällen keinen Babysitter braucht, um abends fortgehen zu können und auch das nötige Geld für ein paar Kurzurlaube mit Musik hat.
Man kann fehlenden Nachwuchs beklagen, aber bitte ohne das ältere Publikum zu dissen!
Lieber Markus, bzgl. der von Dir diagnostizierten „Vergreisung“ des Publikums avantgardistischen Freestyle-Geschehens bin ich mittlerweile weniger pessimistisch als noch vor einigen Jahren. Auf den genannten Festivals (unbedingt hinzuzufügen sind natürlich die legendären „Konfrontationen“ in Nickelsdorf, Saalfelden hingegen würde ich in dem Zusammenhang mittlerweile eher weglassen), sind schon auch einige jüngere Semester anzutreffen, und mir mag scheinen, in durchaus (leicht) steigender Zahl! Dies ist keineswegs zuletzt dem wachsenden Anteil an Frauen, sowohl auf der Bühne als auch davor, geschuldet. Hier ist bei den einschlägigen Veranstaltern in den letzten Jahren ganz klar das Problembewusstsein gestiegen, die „Männerdomäne“ Free&Improvised Music gendermäßig zu öffnen. (Ungeachtet der Altersproblematik erfreuen sich besagte Veranstaltungen seit einigen Jahren übrigens regen Zulaufs, auch die „artacts“ letztes Wochenende waren so gut besucht wie nie, Wels, Ulrichsberg, Nickelsdorf platzen stets aus allen Nähten, von einem „biologisch bedingten Nachfrageschwund“ ist hier jedenfalls nichts zu merken.) Das experimentell ausgerichtete „Klangfestival Gallneukirchen“ in OÖ bspw. war letzten August sogar weit überwiegend von unter 35jährigen frequentiert, freilich in einem Setting ganz ohne spießige Sitzplatzreservierer und mit der Möglichkeit im Freien zu campen, darüber hinaus war der Obulus freiwillig zu entrichten (was sich finanziell dank reger Spendenbereitschaft tatsächlich ausgegangen ist). Auf dem „Incubate-Festival“ im niederländischen Tilburg habe ich die letzten Jahre ähnlich erfreuliche Erfahrungen gemacht, was den „Nachwuchs“ für queere, weirde, experimentelle Sounds anbelangt. Gerade die längst vollzogene Öffnung des (Free) Jazz zur Elektronik attraktiert hier juvenilere Hörerschaften, speziell computergenerierte Klangforschungen („Elektroakustik“) und natürlich Noise („der neue Punk“?) vermögen als konzeptionelle Weiterentwicklungen freier, improvisierter Musik vergleichsweise junge Musiker/innen anzusprechen, wovon man sich ja auch in Ibk auf dem „Heart of noise“ ein Bild machen kann. Hinsichtlich Deiner Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen kommerziellen Konzessionen an den Mainstream und einem Be- und Verharren auf und im „dogmatischen Nicht-Dogmatischen“, wäre mein Vorschlag letztlich also gerade kein Zurückrudern und damit Glattbügeln und Weichwaschen krawallöser freier Musik, sondern im Gegenteil: Noch mehr Mut zum Experimentellen, aber konzeptionell noch breiter aufgestellt, mit traditionellen Instrumentationen ebenso wie mit elektronischen Ansätzen, ein höherer Anteil an Frauen im Lineup und ein organisationaler Rahmen, der Geringverdiener nicht ausschließt und jüngeres Publikum nicht durch opernhafte „Sitzplatzmumien“ abschreckt.