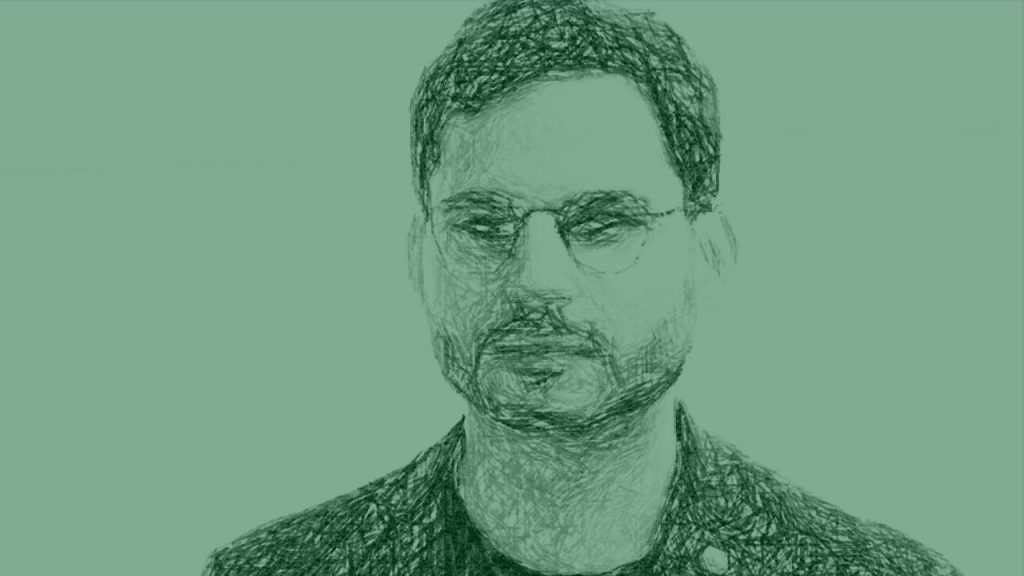Wenn früher jemand etwas nicht sehen wollte und stur in eine Richtung geschaut hat, gab es von Lehrenden mit einem pädagogischen Händchen gerne die Aufforderung: „Du musst die Augen nach innen drehen, dann siehst du es!“
Hinter dieser okularen Übung steckt nichts anderes, als die Idee des Perspektivenwechsels.
Eine der ersten Übungen, die es im Verlaufe eines Literaturstudiums zu bewältigen gilt, ist jene mit dem Perspektivenwechsel. An manchen Unis wird sie als eine Art Aufnahmeprüfung absolviert in der Hoffnung, dass jeder die Finger von der Literatur lässt, wenn er einmal einen Perspektivenwechsel gemacht hat.
Klassische Perspektivenwechsel für eine solche Übung sind:
– der Student versetzt sich in die Rolle des Professors und ist plötzlich angewidert vom eigenen Fach, das sich als Luxus herausstellt, der nichts mit den wahren Fragen des Lebens zu tun hat
– ein religiöser Funktionär legt unter der Kutte Hand an sich und verströmt zur Tarnung Weihrauch, muss aber erkennen, dass er nichts sieht, als er sich in die Rolle von Gott versetzt, weil es den es offensichtlich nicht gibt
– ein Lyriker versetzt sich in die Rolle des Gedichtes, das er soeben produziert hat, und muss feststellen, dass ihn dieses verachtet, weil es Nonsens ist
– ein Leser beginnt einen Krimi und versetzt sich aus Versehen in die Rolle des Opfers, statt des Kommissars, er regt sich wegen dieser Ungerechtigkeit dermaßen auf, dass er nie mehr einen Krimi liest
Ein Großteil der Studienanfänger lässt sich durch diese Eingangsübung abwimmeln, ein literarisches Fach zu studieren. Die Hartgesottenen freilich überwinden diese Übungen spielend und machen ein Dogma daraus:
Literatur entsteht dann, wenn du die Augen nach innen drehst und alles anders siehst!
Wenn man diese These mit einem Titel „Bachelor to go“ absichert, lässt sich damit sogar Geld verdienen in den klassischen Berufen Buchhändler, Rezensent oder Bibliothekar.
Meist fahren diese Leute ein Leben lang gut mit der Überlegung, einen anderen Blick auf die Welt zu werfen und sei es nur ein „inniger“ mit hermetisch nach innen gerichteten Sinnesorganen.
Als Glossenschreiber kommt einem diese Haltung selbst im hohen Alter noch zugute, indem man sie Lebenserfahrung nennt.
Und tatsächlich, wenn man die Dinge umdreht, ergibt sich plötzlich ein überraschend heller Sinn.
So entsteht Migration meist dadurch, dass sich ein Staat aus einem Gebiet zurückzieht und alles in Gewalt und Elend hinterlässt, sodass die Bevölkerung fliehen muss.
Diese wird meist an der Grenze des zu fliehenden Staates in Lagern aufgefangen und von Hilfsorganisationen mit Grundnahrungsmitteln, Medikamenten und Elementarbildung versorgt.
In Pandemien und ähnlichen Katastrophen zieht sich hingegen die Bevölkerung in ihre Behausungen zurück und entleert den öffentlichen Raum, sodass der Staat fliehen muss. Dieser findet vorübergehend in akademischen Gremium Unterschlupf und stellt die interessante Frage, ob es in einem geflohenen Staat nicht doch die wahre Freiheit gibt.
Vom Weltraum aus gesehen macht es keinen Unterschied, ob die Menschen in Lagern oder Lockdowns wohnen, in beiden Fällen regieren Perspektivlosigkeit und Lagerkoller.
Unter dieser Annahme macht es letztlich auch keinen Sinn mehr, wenn sich Migranten auf den Weg machen, um vom einen Lager ins andere zu wechseln. Der psychische Zustand ist in beiden Fällen ähnlich, es werden nur andere Wörter für den Sachverhalt verwendet.
Ein kluger Perspektivenwechsel erspart einem in diesem Fall Schlepperkosten und Enttäuschungen, wenn man „sieht“, dass es vor und hinter dem Stacheldraht gleich zugeht.
STICHPUNKT 23|22, geschrieben am 13.03.2023