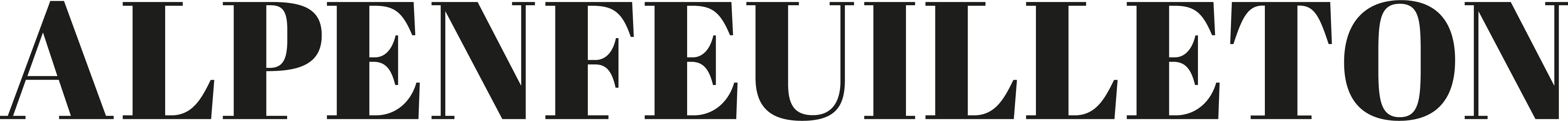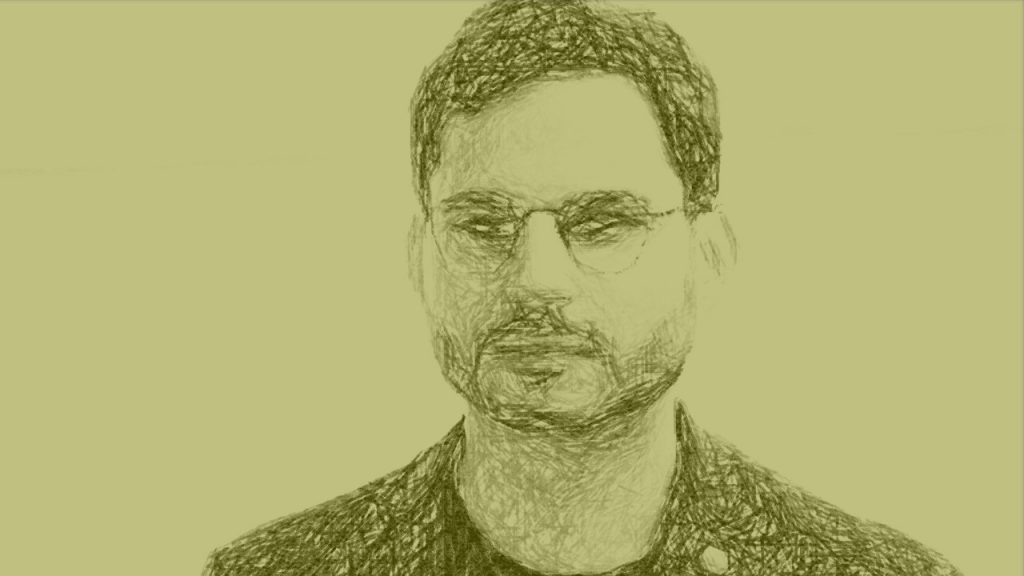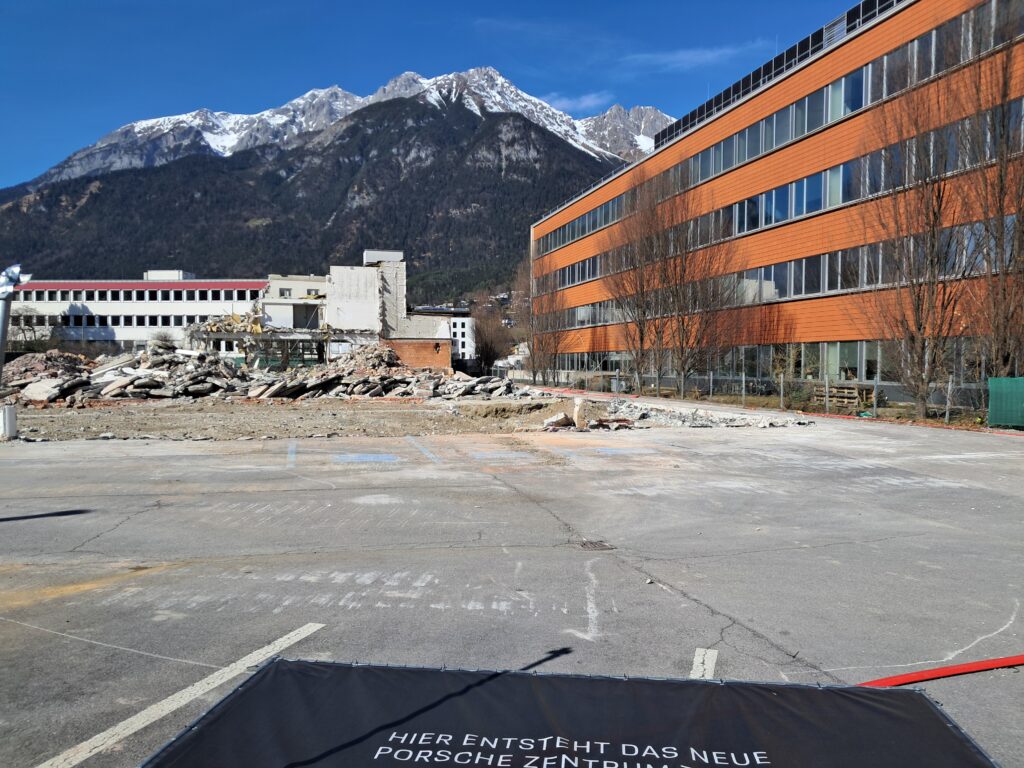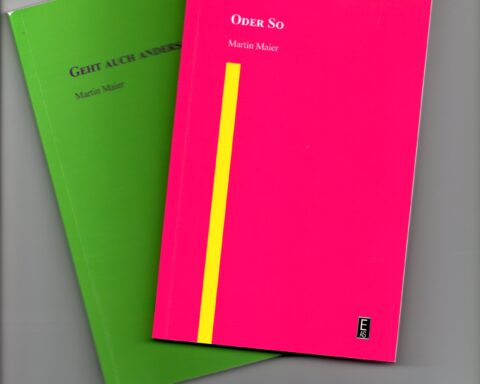Früher herrschte die Überzeugung, der Name sei Vorbestimmung. Deshalb ging man besonders vorsichtig mit der Namenswahl um. Einem X Æ A-Xii oder einem Seldon Lycurgus, wie zwei der bemitleidenswerten Sprösslinge von Elon Musk heißen, hätte man in früheren Zeiten keinerlei Überlebenschancen vorausgesagt. Allein schon dem Vornamen nach, auch ohne Kenntnis der abstrusen Verfasstheit seines Vaters, hätte man sie als Ausgeburten des Teufels bezeichnet.
Inzwischen geben Vor- wie Nachname uns leider keine Orientierung mehr. Sie sind beliebig änderbar. Name wie Charaktereigenschaften können sozusagen „situationselastisch“, je nach Marketing-Vorgaben, angepasst werden.
Dementsprechend sind auch in der Politik Namensänderungen inzwischen gang und gäbe, bevorzugt bei rechten Parteien. Das entlastet juridisch von der Verantwortung für vergangene Missetaten und signalisiert Neues, ohne jedoch das gewohnte Programm antasten oder Personen austauschen zu müssen. Sobald der letzte Skandal verraucht ist, kann man ja unterm alten Namen mit dem gleichen Personal weitermachen, siehe VdU — FPÖ – LIF –BZÖ– FPÖ.
Diesen Verkaufstrick versuchte die Kurz-ÖVP nachzuahmen. Allerdings wollte die Partei partout nicht auf ihren Anspruch, „das Volk“ zu vertreten, verzichten. Deshalb beschränkte man sich auf bloßen Farbwechsel. Seither changiert die ÖVP zwischen Türkis und Schwarz, was aber partout keine schöne Mischfarbe ergeben will. Und „das Volk“ hat sich, trotz alledem, ein anderer unter den Nagel gerissen.
Linke Parteien hingegen zeigen sich, was Namensänderungen angeht, noch unflexibel, was vielleicht ein Grund für ihre schrumpfenden Marktanteile ist. Ihre Farbe bleibt das seit Urzeiten immergleiche Rot, nicht einmal in Nuancen abgewandelt. Die Kommunisten nennen sich, ungeachtet historischer und programmatischer Verwerfungen, weiterhin „Kommunisten“. Die deutsche Linke bleibt stur in Ost und West „Die Linke“. Einzig die SPÖ hat sich, unentschlossen, ein ganz klein wenig bewegt: erst von „Sozialdemokratischer Arbeiterpartei“ zu „Sozialistischer Partei“ und später zurück zur „Sozialdemokratischen Partei Österreichs“. Ihr sind im Verlauf ihrer Geschichte also nur die „Arbeiter“ abhandengekommen.
Dennoch. Trotz der Beliebigkeit heutiger Namensgebung scheinen manche Namen immer noch schicksalhafte Bedeutung zu besitzen. Vielleicht werden deshalb bald einzelne Regierungsmitglieder auf die Möglichkeiten der Namensänderung zurückgreifen müssen. Christian Stocker zum Beispiel, unser neuer Bundeskanzler, muss sich vielleicht, wenn einmal in alter Tradition wieder alle Regierungsvorhaben ins Stocken geraten, zu Christian Macher umbenennen lassen. Oder sollte Andreas Babler als Medien-ungeschulter Babbler verunglimpft werden, könnte er sich, falls er sich das zutraut, zu Andreas Vordenker umschreiben lassen.
Markus Marterbauer hat als Finanzminister ebenfalls einen allzu prophetischen Namen. Man fragt sich nur, ob ihn dieser zum Folterknecht oder zum Märtyrer vorherbestimmt. In Zeiten allumfassender Täter-Opfer-Umkehr wird das wohl erst die Geschichte klären — falls er mit einem solchen Namen überhaupt die zu erwartenden Angriffe von allen Seiten überlebt.
Bei Landwirtschaftsminister Totschnig hingegen ist schon längst Hopfen und Malz verloren; hierzulande assoziiert man mit seinem Namen unwillkürlich einen „Totsch“, einen armen Tölpel. Und Innenminister Karners Name ordnet ihn in eine mögliche Abstammungslinie von Karrnern, fahrendem Volk, ein, von dem er sich doch seit Jahren vergeblich zu distanzieren versucht. Ganz arm dran ist schließlich der neue Unterrichtsminister Christoph Wiederkehr, dessen Name all seine Reformideen fürs Bildungssystem zu konterkarieren droht.
Da bleibt also nur inständig zu hoffen, dass Nomen einmal nicht Omen ist!