Der Besuch der Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod.“ in der Innsbrucker Hofburg hat für mich schon im Vorfeld Fragen aufgeworfen. Soll und kann man mit Kinder über den Tod, über das Sterben überhaupt reden? Mit welcher Sprache? Was klammert man aus, was muss unbedingt besprochen werden? Ist das Thema Tod für einen jungen Menschen, der höchstwahrscheinlich noch sein ganzes Leben vor sich hat, überhaupt relevant?
Reicht es nicht, diese unangenehmen Dinge dann zu besprechen, wenn sie wirklich ins unbeschwerte Leben einer hoffentlich glücklichen Kindheit eindringen? Ich weiß es nicht. Aber seit einigen Tagen habe ich mir zumindest ausgiebig zu diesen Fragen Gedanken gemacht.
Wir entschieden uns letzten Samstag dafür, die besagte Ausstellung zu besuchen. Obwohl unsere Kleine noch keine vier Jahre alt ist. Obwohl wir daran zweifelten, dass sie alles verstehen würde. Bei unserer Großen waren wir uns schon sicherer, dass sie einige der Dinge und Themen in ihrer vollen Tragweite richtig auffassen würde.
Genau davor hatten wir aber noch mehr Angst. Wie würden wir auf ihre Fragen antworten? Würden wir das richtige sagen? Würde sie die Ausstellung irritiert verlassen und würden Fragen in ihr wühlen, die weder sie noch wir beantworten konnten?

Interessanterweise ist es mir kein besonders Anliegen, die überaus gelungene Ausstellung exakt zu beschreiben. Es ließe sich ohne Zweifel eloquent über diese außergewöhnliche Ausstellung schreiben, die in Sachen Museumspädagogik wirklich alles richtig macht. Es ließen sich höchstwahrscheinlich auch Vergleiche zu anderen, ähnlich gearteten Ausstellungen anderswo ziehen.
Eine objektive Schreibweise würde das vermutlich sogar verlangen. Nur: Ich bin betroffen. Direkt. Unmittelbar. Kein Wissen und keine Gelehrsamkeit der Welt kann dieses Thema von mir fern halten. Ich kann und will es nicht objektivieren, nicht wegschieben, nicht einer vergleichenden und kulturtheoretischen Analyse unterziehen. Ich möchte es ganz an mich heranlassen. An mich als Mensch. An meine Rolle als Vater von zwei Kinder.
Die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod“: Wie mit dem Tod umgehen?
Es ist jedenfalls bezeichnend, dass mich nicht die Ausstellung selbst betroffen macht. Dabei ist die Ausstellung klug gemacht und gekonnt in Szene gesetzt. Es sind definitiv einige Ansätze dabei, wie sich mit Kindern über den Tod reden ließe. Zum Beispiele mit Metaphern der Vergänglichkeit. Wie eine Blume wächst, gedeiht und dann wieder verblüht, sind auch wir Menschen dazu gemacht, um zu wachsen, zu gedeihen und dann wieder zu verblühen.

Auch ein Vergleich mit dem Leben anderer Lebewesen wäre sinnvoll. Wir und unsere Kinder würden dann merken, dass es nicht viele Lebewesen auf der Erde gibt, die länger als wir leben. Wir könnten uns auch damit beschäftigen, dass in Mexiko ganz anders mit dem Tod und dem Sterben umgegangen wird. Damit würde deutlich werden, dass unser Umgang mit dem Tod nicht alternativlos ist. Dem Tod kann auch mit anderer Ritualen und anderen Verhaltensweisen begegnet werden.
Was würden wir tun, wenn der Tod mit uns am Frühstückstisch säße?
Wir könnten uns auch darüber freuen, dass der gestorbene Mensch jetzt in einem Paradies ist, es ihm dort besser geht. Dass er uns fehlt, erschiene uns dann beinahe schon egoistisch. All das regt diese Ausstellung an.
Das alles würde davon erzählen, welch interessanten Diskurse und diskursiven Anschlussmöglichkeiten hier aufgemacht werden. Nach dieser Ausstellung kann man, aufgeladen mit ganz vielen möglichen Antworten und Methoden, ein wenig klüger den Raum verlassen. Man wäre dann nicht mehr so hilflos, was das Reden über den Tod betrifft.

Man könnte bereits am Frühstückstisch am nächsten Morgen das eine oder andere Thema streifen. Beispiele für Menschen, die bald sterben werden, fände man auch problemlos. Der Tod säße also am Frühstückstisch mit dabei und hätte seinen Schrecken ein wenig verloren. Zumindest aber wäre er benannt und wäre somit der Unsagbarkeit und Tabuisierung entrissen. Ein mögliches Ziel, das man erreichen sollte, wenn man Kinder richtig und ohne das Tabu des Todes erziehen wollte. Ein löbliches, hehres Ziel.
Wie mit der eigenen Betroffenheit umgehen?
Es gibt nur ein Problem. Ich schaffe es nicht. Meine aktive und aufmerksame, mit meinem Vorwissen über Ausstellungen generell gespeiste Rezeption kollabierte am vergangenen Samstag. Alle Begriffe, Methoden und Erklärungsversuche versagten. In einem Moment traf es mich direkt, unvermittelt, ganz ohne Schutz.
In einem Raum, ganz in Weiß gehalten mit einem weißen Sarg (im Titelbild zu sehen), sollten Besucherinnen und Besucher Nachrichten an die Toten hinterlassen. An ihre Verstorbenen. Natürlich taten das auch Kinder. Eine Zeile trieb mir die Tränen in die Augen: „Papa ich vermisse dich – dein Michi“. Hinter der krakeligen Schrift eines Kindes versteckte sich das Unsagbare. Unfassbare. Ich wurde still und verließ den Raum.
Was, wenn unsere Kinder direkt vom Tod im engsten Familienkreis betroffen wären? Wie würden sie damit umgehen? Ich weiß es nicht.

Noch etwas faszinierte mich an diesem Satz: Seine Direktheit und seine Klarheit. Das Kind schreibt schließlich nicht, dass es unendlich traurig ist, dass sein Papa nicht mehr da ist. Es schreibt, dass es ihn vermisst. Er fehlt. Er ist nicht mehr da. Damit wird die Situation auf den Punkt gebracht.
Der Tod hinterlässt eine Lücke, eine Leere. Diese Feststellung lenkt die Frage darauf, wie wir mit dieser Lücke, mit dieser Leere umgehen. Können wir diese Lücke und diese Leere ertragen? Kompensieren wir sie? Ignorieren wir sie? Oder lernen wir mit dieser Lücke zu leben und begreifen sie als Teil unseres neuen, veränderten Lebens, das nach dem Tod eines geliebten Menschen nie mehr dasselbe sein wird?
Das ist für mich eine mögliche „Antwort“, wie wir mit dem Thema Tod in Gegenwart unserer Kinder umgehen sollten. Nicht mit klugen, pädagogisch wertvollen Methoden. Diese können dabei helfen, überhaupt erst eine Sprache und Begriffe zu finden, um verstehbar zu machen, womit wir es zu tun haben.
Vielmehr glaube ich aber, dass wir das Leben mit dem Tod vorleben müssen. Wir müssen unsere Wunden sichtbar machen. Zeigen, wo in unserem Leben eine Lücke klafft. Wir müssen diese Lücke mit Erzählungen benennen und skizzieren. Mit Erzählungen, die diesen lieben, vermissten Menschen wieder ins Hier und Jetzt holen. Zumindest für ein paar Augenblicke.
Der Tod macht betroffen. Sprachlos. Und genau das soll er auch. Wer glaubt, die eine richtige Sprache gefunden zu haben, der irrt sich. Den Tod müssen wir immer wieder an uns heranlassen. Ganz ohne Filter und ohne Distanz. Eine Ausstellung wie „Erzähl mir was vom Tod.“ kann uns diese Tatsache bewusst machen. Und genau das macht sie wertvoll.


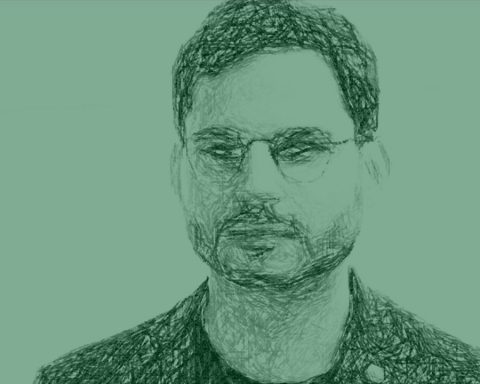







Sehr geehrter Herr Stegmayr,
ich finde ihren Beitrag über die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod“ einfach großartig. Es ist so selten, dass ein Journalist (sind sie das?) und dann noch ein männlicher Journalist so ehrlich und offen über seine Gefühle schreibt.
Herzlichen Dank!
Ich arbeite seit 10 Jahren bei der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft; bin für die Öffentlichkeitsarbeit einerseits und Trauerbegleitung andererseits zuständig. Trauer an sich ist in unserer Zeit und Gesellschaft ja alles andere als willkommen. Ich bin aber überzeugt und mache immer wieder die Erfahrung, dass Trauer, die ja durch die nicht füllbare Lücke entsteht, ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Die Lücke kann und darf nicht gefüllt werden, damit wir trauern können und dürfen. Denn ich stimme Jesper Juul voll und ganz zu: „Die Trauer ist der untrennbare Zwilling vom Glücklichsein.“
Mit schönen Grüßen Maria Streli-Wolf
Eine faszinierende Idee – und ein toller, persönlicher Artikel darüber! Und auch Ihre Conclusio trifft genau ins Schwarze. Wer das übrigens selbst nicht schafft, kann sich Hilfe bei TrauerbegleiterInnen holen.