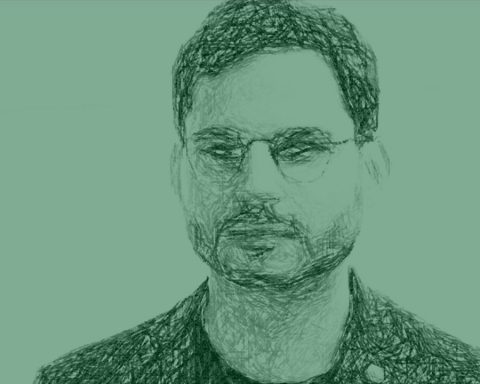Kinder stellen meist sehr interessante Fragen. Diese eine Frage meiner Tochter traf mich wie aus heiterem Himmel. Ja: Ich war unvorbereitet. Sie fragte mich jedenfalls, nachdem ich begonnen hatte ihr das eine oder andere Konzert zuzumuten, warum Musik eigentlich wichtig sei. Meine Antwort darauf war schlicht: Weil sie uns glücklich macht und weil uns, wenn wir uns nicht mit möglichst viel Musik beschäftigen, bestimmte Arten von Musik verschlossen bleiben und wir die damit verbunden Form von Glück gar nicht kennen lernen können.
Wie aber lässt sich die Sache angehen? Das Zauberwort, das sich in dieser Sache anbietet ist einfach benannt: Musikvermittlung. Man hole Komponisten, Dirigenten und so manchen virtuosen Musiker vom jeweiligen Sockel herab, lasse die Sache mit der Heldenverehrung sein und verorte den jeweiligen Komponisten in seiner jeweiligen Zeit und beschreibe ihn als Menschen, nicht als unerreichbares Genie. In dieser Sache war es für mich vor einiger Zeit mit das Interessanteste, einem Workshop für das Improvisieren mit Kindern beizuwohnen.
Der Leiter des Workshops meinte dann später zu mir, dass man auf diese Weise klarmache, wie Musik entstehe. Oder vielmehr entstehen könne. Klar ist: Musik ist etwas, das prinzipiell jedem, ob auf der Ebene der Rezeption oder auch Produktion, offen steht. Nicht jeder muss dabei ein brillanter Musiker werden und sein. Es ist aber wichtig, den kreativen Schaffensprozess vom mystischen Anstrich zu befreien und ihn wieder dazu zu machen, was er eben ist: Viel Arbeit, einiges an Talent und ganz viel Übung. Ein Werk hat immer auch eine Geschichte, einen Entstehungsprozess. Diesen gilt es zu vergegenwärtigen.

Ein ähnlicher Prozess lässt sich bei der Musikvermittlung feststellen, die dem 2. Symphoniekonzert des Tiroler Symphonie Orchesters Innsbruck voranging. Schülerinnen und Schüler des BRG Adolf-Pichler-Platz hatten der Intention nach genau das gemacht, was ich hier kurz thematisiert habe: Sie holten Komponisten, Dirigenten und Musiker von dem Sockel der hohen Kunst und interviewten zum Beispiel den brillanten Dirigenten Ainars Rubikis.
Komponisten wurden in ihrem jeweiligen Zeitkontext verortet und das Thema der Liebe beim Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde ins Heute geholt. Liebe geht uns schließlich alle an, nicht nur den kanonisierten Komponisten. Zu guter Letzt wurde sogar noch ein eigenes Stück im Anschluss an das Werk „Psychokosmos“ zum Besten gegeben. Alles sehr engagiert und löblich. Nur: Ob es so funktioniert, die jeweiligen Werke einem jüngeren Publikum und dem Publikum ganz generell zugänglich zu machen?
Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass einige Aspekte dieser Art von Musikvermittelung vom Werk weg führten, der Beschäftigung mit dem Werk nicht zuträglich waren. Tatsächlich stellt sich die Frage natürlich, was uns ein Werk im Heute sagen könnte. Aber müssen wir dazu wissen, dass dieser oder jener Komponist vielleicht an Liebeskummer gelitten hat? Eine Gefahr steht hier im Raum: Die Gefahr der Trivialisierung von Werken, mit denen man sich Ton für Ton und Motiv für Motiv auseinandersetzen sollte.
Das Wissen um das übergeordnete Thema, sei es Liebe, sei es Hass oder was auch immer, vereinfacht das Werk tendenziell und lässt es nicht in seiner Komplexität zutage treten. Vorbildhaft und absolut beispielgebend dagegen war die Komposition, die im Anschluss an das Werk von Peter Eötvös erarbeitet wurde. Hier wurde deutlich, was Musik und grandiose Kompositionen sein können: Nämlich nicht Werke, vor deren Genialität man in Ehrfurcht erstarren sollte, sondern Ausgangspunkte. Möglichkeitsräume, an denen man sich abarbeiten kann. Es sind auch herrliche Möglichkeiten, die eigene musikalische Sprache zu entwickeln, ähnlich dem lernen von Vokabeln. Musik ist eine Sprache, die erlernt werden muss. Damit man die Musik dann versteht, wenn man sie braucht.

Was tun mit Neuheit?
Nach der Musikvermittlung ging es zur Sache selbst. Zu den Werken. Auf dem Programm standen die Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter Eötvös mit „Psychokosmos“ und Ludwig van Beethovens „Eroica“. Dem Orchester muss ebenso ein Kompliment gemacht werden wie den Köpfen hinter der Programmzusammensetzung. Es begann sehr eingängig, zugänglich, flirrend, schwebend frei und einladen mit der besagten Ouvertüre, nur um dann mit „Psychokosmos“ ein paar Grade an Sperrigkeit zuzulegen. Für mich war dieses Stück der eindeutige Höhepunkt des Konzertes. Folkloristische Elemente wechselten sich mit spannenden orchestralen Passagen ab.
Eötvös verarbeitet hier seine ungarische Herkunft, symbolisiert durch das Zymbal. Der Applaus, wohl auch für den fantastischen Solisten Luigi Gaggero, war, zu meiner Überraschung, stärker als beim ersten Werk. Die Stimmen hinter mir und um mir in der Pause zeichneten aber ein zum Teil anderes Bild. Von unangenehmen Tönen war da die Rede, und dass Orchester das im Heute halt auch machen müssen, ansonsten sei man bald weg vom Fenster.
Klar war: Nicht jedermann und jederfrau konnte mit diesem Werk etwas anfangen, obwohl auch in dieses Stück generöse Einladungen ausgestreut waren, um einen Zugang zu diesem und in dieses Werk zu erlangen. Versteht man erst die Logik hinter diese Komposition, dann ist daran rein gar nichts sperrig, irritierend, sondern die Dialoge zwischen Solo-Instrument, zwischen ruhigen und lauten Passagen sind absolut logisch und zwingend.
Die „Eroica“ nach der Pause war, erwartungsgemäß, ein Triumph. Hervorragend gespielt, beim Publikum begeistert aufgenommen. Wie gut die Aufführung dann im Detail wirklich war, überlasse ich wirklichen Experten und solchen Leuten, die dieses Werk schon mehrere Male in verschiedensten Kontexten gehört haben. Ich jedenfalls war begeistert von der Klarheit, Transparenz und Souveränität mit der hier an und durchs Werk gegangen wurde.
Klar ist jedenfalls, dass nicht alles klar war. Und die Musikvermittlung letztlich gegen Windmühlen kämpft: Gegen ein Publikum, das bestimmte Erwartungshaltungen an ein Symphoniekonzert hat, die von Werken wie dem von Eötvös zum Teil in Frage gestellt werden. Die Frage ist also gestellt: Wie macht man Musik zu etwas, das einfach nur glücklich macht? Wie wird die Lebendigkeit des Werkes betont und wie bringt man Leute dazu, sich wirklich mit dem Hören eines Stückes auseinanderzusetzen, das ihnen vielleicht (noch) unbekannt ist?
Nicht nur das Wiederhören von Altbekanntem macht glücklich, sondern für mich ist Glück vor allem einen Zugang zu etwas Neuem zu finden. Vielleicht kann an dieser Stelle eine Art von Musikvermittlung anschließen, die das hören lernt, das Hinhören? Für mich persönlich wäre eine solche „Anleitung“, nicht nur für junge Menschen sondern für Hörerinnen generell, die wahre Musikvermittlung. Jedes Werk ist ein Angebot, seine eigene musikalische Sprache zu erweitern und beim nächsten Mal noch mehr zu verstehen. Wer möglichst viel versteht und das Glück, das auch schwierigen Werken innewohnt, spürt, der hat verstanden, worum es bei Musik wirklich geht. Dann, und nur dann macht Musik wirklich glücklich.
Musik macht glücklich!
Könnte dich auch interessieren
Elfenbeinturmbewohner, Musiknerd, Formfetischist, Diskursliebhaber. Vermutet die Schönheit des Schreibens und Denkens im Niemandsland zwischen asketischer Formstrenge und schöngeistiger Freiheitsliebe. Hat das ALPENFEUILLETON in seiner dritten Phase mitgestaltet und die Letztverantwortung für das Kulturressort getragen.