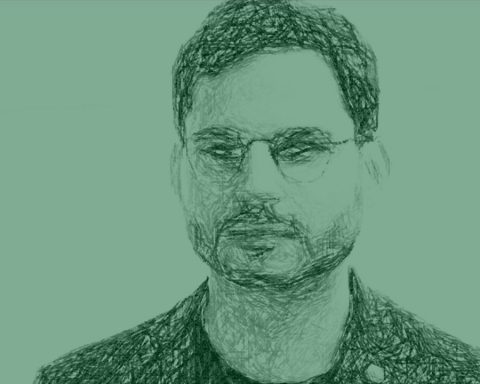Es scheint als ob von Zeit zu Zeit immer mal wieder Theorien, Haltungen und Diskurse auf Tirol überschwappen und sich in Innsbruck einnisten würden. Dann wird darüber ein Theaterstück gemacht und Theorien werden zur Grundhaltung für ganze ästhetische und künstlerische Konzepte. Ob es aber interessant ist, wenn über mehr als eine Stunde Theorien, im gestrigen Fall die „Pataphysik“, ausgebreitet werden steht wieder auf einem anderen Blatt. Die Frage ist auch, ob sich daraus schlüssige, zumindest aber interessante ästhetische Positionen ableiten lassen.
Epigonia. Eine pataphysische Oper. Das klingt erst einmal nach Größenwahn. Nach einem übergroßen Anspruch, der eigentlich unerfüllbar ist. Und die Pataphysik ist zugleich auch schon wie eine vorangestellte Entschuldigung für den Fall, dass Dramaturgie, Aufbau, Stringenz und Logik des Stücks scheitern. Die Patapyhsik will es schließlich so. Kein Sinn mehr, nirgends. Niemand weiß mehr, was eigentlich Sache ist. Chaos regiert. Oder ist es doch die Vielfalt, die Vielheit, das Uneindeutige und die Komplexität, die sich nicht mehr auf einen Nenner bringen lässt?
Wenn es aber die Komplexität ist, die regiert, warum ist dann vieles im Stück so banal und evident? Warum wurde nicht oder nur kaum an der Beziehung von Musik und Text gearbeitet? Die Musik transportiert die jeweiligen Stimmungen im Stück. Von Verwirrung bis hin zur Melancholie. Von Chaos bis hin zur Verzweiflung. Alles da da da. Wenn dann bei einem freitonalen Stück unkontrollierte Bewegungen der Protagonisten die Konsequenz sind, dann ist die Banalitätsgrenze weit unterschritten.

Unter der Banalitätsgrenze?
Freitonalität symbolisiert Chaos, Unordnung, die dann wiederum zu einer neuen Ordnung findet. Deshalb folgt auch von der Band Donauwellenreiter an diesem Abend viel Poppiges, Gefälliges. Ganz so als wollte diese Musik befrieden, das zerbrochene Ganze wieder heil machen. Es ist alles furchtbar kompliziert, aber immerhin können wir uns noch in musikalischem Wohlklang und im Einfachen und Melodischen suhlen und einnisten. Melancholie rules. Alles so schön warm dort.
Über dieses Stück zu sprechen ist wie zu Architektur zu tanzen. Worüber soll man schreiben? Über die schauspielerische Leistung bei der unklar ist, ob sie teilweise wirklich so schlecht ist oder ob diese ganz einfach eine pataphysische Haltung spiegeln soll? Dann gleiten aber auch jegliche Bewertungsmöglichkeiten ab und eine Einschätzung der Qualität des Stücks wird unmöglich.
Die Musik verhält sich stets kaum zum Text, der Text nimmt kaum auf die Musik Bezug. Absicht? Oder Achtlosigkeit? Müssen sich diese überhaupt zueinander verhalten oder ist das schon wieder zu viel der Sinnzuschreibung? Können sich diese nicht auch indifferent gegenüberstehen, jeder in der eigenen Welt? Ist das dann Komplexität, da damit ein Verhältnis benannt ist, das nur schwer oder gar nicht zu beschreiben ist? Weder mit Kontrapunkt, noch mit Entsprechung? Müsste aber nicht viel mehr eine andere, noch komplexere Logik entwickelt werden, die der Komplexität der Situation entspricht?

Die mit Abstand stärkste Passage des Stücks ist die Szene, in der eine Protagonistin versucht eine klare Ansage zu machen, sich diese Ansage aber verliert in Hall, Überlagerungen, Stimmverfremdungen. Die Sprechende kann nicht mehr steuern, was mit ihrer Aussage passiert. Letztlich verliert sich die Aussage und der Sinn in den Effekten. Der Fokus wird auf die Form gerichtet, auf die Schönheit des Klangs, geht weg von dem Inhalt, von der Aussage selbst.
Ist das eine Entschuldigung, warum die Inszenierung bei „Epigonia“ scheitert? Kann der Schöpfer des Stücks nichts mehr sagen, sondern verliert er sich zwangsweise ständig in irgendwelchen Nebenschauplätzen? Man könnte aber auch annehmen, dass damit der Blick auf die pure Schönheit des Augenblicks, des Einzelnen, des Partikulären gelenkt wird, das kein großes Ganzes mehr ergibt, keinen Sinn mehr machen will.
Genau darin liegt das Problem des Stück: Die einzelnen Szenen sind keine Augenweide, kein intellektueller Genuss, sondern meist nur banal und reizlos. Der Zusammenbruch von Stringenz fördert keine einzelnen Perlen zu Tage, sondern der fehlende Schwung und der fehlende Sog des Stücks wirft einen auf einzelne Szenen zurück, die auch bei einer Suspension der eigenen Sinnerwartung nicht funktionieren.
Also scheitern auf hohem Niveau? Wohl kaum. Denn scheitern setzt ein Ideal voraus. Pataphysik, so legt dieses Stück nahe, braucht diese Ideale nicht mehr. Ob sich das der Zuschauer antun will, ist dabei wieder eine andere Frage.
Epigonia im Treibhaus Innsbruck: Die Komplexität der Welt
Könnte dich auch interessieren
Elfenbeinturmbewohner, Musiknerd, Formfetischist, Diskursliebhaber. Vermutet die Schönheit des Schreibens und Denkens im Niemandsland zwischen asketischer Formstrenge und schöngeistiger Freiheitsliebe. Hat das ALPENFEUILLETON in seiner dritten Phase mitgestaltet und die Letztverantwortung für das Kulturressort getragen.