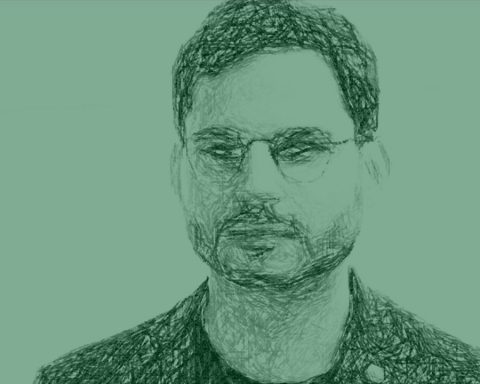Die Musik der deutschen Cellistin Anja Lechner wagt sich immer wieder an die Ränder und vereint verschiedene ästhetische und musikalische Welten. Sie ist eine klassisch ausgebildete Cellistin, interessiert sich aber auch stark für die Improvisation. Im Interview sprach sie über ihren Weg in die Improvisation, Freiheiten die sich der Interpret nehmen darf und Komponisten, die ihr besonders am Herzen liegen.
Mich würde interessieren, welche Funktion die Improvisation in deiner Musik einnimmt.
Ich habe in ganz kleinen Schritten angefangen zu improvisieren. Das war so mit 16. Insofern hat das eigentlich meinen klassischen Weg immer begleitet. Ein neuer Abschnitt begann für mich dann, als ich mit Musikern wie Dino Saluzzi, François Couturier,Vassilis Tsabropoulos oder auch mit Mark Feldman oder Misha Alperin zu improvisieren begann. Es war eine ganz neue Herausforderung neben meiner Arbeit mit dem Rosamunde Quartett, die sich dann noch intensivierte nach der Auflösung des Quartetts, vor fünf Jahren.
Für mich war es oft ein Wechselspiel zwischen der Frage, ob es mich mehr verunsichert oder beflügelt zu improvisieren oder ein Beethoven Quartett zu spielen. Das sind zwei verschiedene Welten, die manchmal nicht so einfach zusammenzubringen sind, die sich aber gegenseitig befruchten. In der klassischen Musik kann man das Werk monatelang üben, in der Improvisation sollte alles aus dem Moment heraus entstehen. Letztendlich geht es aber in beiden Bereichen immer darum, im entscheidenden Moment fliegen zu können.
Es geht auch immer wieder um die Frage, wie man Empfindungen überhaupt schriftlich festhalten kann. Wenn man mit zeitgenössischen klassischen Komponisten arbeitet, ergeben sich oft ähnliche Situationen. Viele sind offen für die Vorschläge des Interpreten und spontan bereit Dinge zu ändern, die nicht ihren Klangvorstellungen entsprechen. Seitdem gehe ich auch mit klassischer Musik freier um.

Würdest du sagen, dass Improvisation eine Möglichkeit ist, Stücke und Werke zu „vergegenwärtigen“, sie in die jetzige Situation hereinzuholen?
Ja, das sollte Musik immer tun. Musik ist ja nichts Altes. Sie entsteht immer im Moment. Ich habe gerade zusammen mit dem armenischen Komponisten Tigran Mansurian gespielt. Vor dem Konzert gab es ein öffentliches Gespräch, wo er über armenische Musik gesprochen hat. Diese ist eine zum großen Teil mündlich überlieferte, nicht notierte Musik. Zusätzlich gibt es aber auch sehr alte Notenschriften, die zu einem großen Teil von Komitas entschlüsselt wurden, einiges davon aber heute immer noch unlesbar ist.
Er meinte, dass es die Aufgabe eines Interpreten ist, den gelesenen Notentext wieder in die überlieferte Form zurückzubringen. Das fand ich sehr interessant, weil man als Interpret oft glaubt, dass man sich nur an die Noten halten muss und ja nichts dazugeben sollte. Man muss die Musik aber eigentlich wieder „re-kreieren“.
Wie würdest du den Grad an Freiheit beschreiben? Wo hat es nichts mehr mit der Werkintention zu tun? Die Gefahr ist ja immer da, oder?
Diese Gefahr ist immer da. Man kann die richtigen Noten auch „richtig“ falsch spielen, wenn man zum Beispiel zu wenig über die verschiedenen Epochen Bescheid weiß und keine Unterschiede in der Artikulation und Phrasierung im Ausdruck macht. Auch das Vibrato sollte nicht automatisch eingesetzt werden. Und wenn man meint, man wüsste alles, kann man falsch liegen, weil man dann nicht mehr offen ist. Selbstverständlich sollte man auch die Musik unserer Zeit und die damit verbundenen Spielweisen kennen und wissen, wie es ist, mit einem Komponisten zu arbeiten.
Das heißt also, dass du dich in eine Spieltradition einreihst. Schaust, wie die Werke bisher gespielt wurden. Und in dieser Sache vermisst du dann die Freiheiten, die möglich sind. Kann man das so sagen?
Eigentlich schaue ich nicht unbedingt wie Musik bisher gespielt wurde, sondern ich lasse mich lieber begeistern. Zum Beispiel von dem großen András Schiff. Wenn ich seine Beethoven Sonaten höre, dann habe ich das Gefühl, dass diese gerade erst im Moment entstehen. Er ist so umfassend gebildet mit einem unglaublichen Überblick, und schafft es im Moment des Musizierens so frei zu sein, dass es klingt, als wäre es improvisiert. Das ist schlichtweg genial. Er geht ja ganz exakt zurück zu den Quellen und zu den Notentexten und er betreibt auch eine intensive Quellenstudie.

Wenn wir bei ihm an J.S. Bach denken, dann liegt nahe, dass Bach auch über die Jahrhunderte zu „romantisch“ gespielt wurde. Er spielt ihn trocken und klar.
Und mit größter innerer Freiheit!
Was mich noch interessiert ist dein Interesse an Werken, die nicht zum klassischen, westlichen Kanon gehören. Warum ist dir das wichtig?
Musik ist Musik, Kategorien existieren für mich persönlich nicht. Manche Musik spricht zu mir, andere Musik hingegen nicht. Manche Musik berührt mich, andere nicht. Oft weiß ich gar nicht warum das so ist. Und natürlich gehe ich der Musik nach, die mich anspricht, ich bin sehr neugierig. Dazu gehört in den letzten Jahren auch die Musik aus dem Grenzbereich zwischen Orient und Okzident. Dadurch sind dann Verbindungen zu anderen Musikern und Komponisten entstanden. Außerdem reise ich gerne in fremde Länder.
Heißt das auch, dass es sich bei eurer aktuellen Duo-CD (mit François Couturier: „Moderato cantabile“) einfach so ergeben hat? Oder war das ein Konzept? Wolltet ihr bewusst „unbekannte“, „randständige“ Komponisten interpretieren?
Für uns sind sie eben nicht unbekannt. Die sogenannten Ränder haben mich immer interessiert. Das sind die Plätze, wo es wirklich spannend ist. Francois Couturier geht es in dieser Hinsicht genauso. Die Komponisten Federico Mompou, Komitas, G.I Gurdjieff und natürlich auch François eigene Musik, begleiten uns, unabhängig voneinander, schon sehr lange. Diese Musik liegt uns nah, verbindet uns und lässt uns genügend Freiraum für Improvisation. Insofern könnte man auch von einem Konzept sprechen.
Ist die Intention diese Komponisten bekannter zu machen?
Ich freue mich natürlich sehr, wenn diese Musik bekannter wird, aber wichtiger ist mir, dass ich mich mit dieser Musik identifizieren kann. Im übrigen war es auch mit dem Tango so. Ich habe in den achtziger Jahren angefangen Tango zu spielen, weil es für mich eine echte Herzensangelegenheit war. Zu dieser Zeit hatte man in Deutschland überhaupt keine Vorstellung davon was argentinischer “Tango Nuevo“ ist. Heute wird Astor Piazzolla in den großen klasssichen Konzertsäalen, sogar auf der Piccolo-Flöte gespielt, weil es angesagt ist Tango zu spielen. Ob man dem Tango damit immer gerecht wird, sei dahin gestellt.
Gibt es neue Projekte, die im entstehen sind?
Es ist eigentlich so, dass ich nie stehen bleibe. Kaum ist etwas abgeschlossen, habe ich auch schon wieder neue Ideen im Kopf. Ich habe Anfang dieses Jahres für ECM die Cellomusik von Valentin Silvestrov aufgenommen. Zusammen mit der französischen Cellistin Agnès Vesterman. Ich spiele seine Musik seit fünfzehn Jahren. Außerdem bin ich immer wieder dabei, mein Solo-Repertoire zu erweitern, mit neuer oder ganz alter Musik. Ich bin sozusagen immer auf der Suche.
Welche Rolle spielte eigentlich Jazz für dich?
Der Jazz spielt für mich eine ganz große Rolle. Aber ich spiele keinen Jazz. Das fände ich vermessen, nachdem ich so lange klassische Musik gespielt habe. Das ist ein bisschen vergleichbar damit, dass ich in Oberbayern aufgewachsen bin, aber meine Eltern nie bayerisch gesprochen haben und deshalb auch ich nicht. Aber ich könnte es. Und wenn ich das tue, dann mache ich es eher aus Spaß, als eine Art von Zitat. Ich würde mich aber nie hinstellen und versuchen normal bayerisch zu sprechen. Ich liebe Jazz und ich höre fast ausschließlich Jazz. Aber ich bin keine Jazzerin. Das witzige ist, dass ich immer wieder mit Jazzern spiele, wie zum Beispiel Francois Couturier, die keinen Jazz spielen. Improvisation ist ein weites Feld, das geht auch ohne die Sprache des Jazz.
Gibt es vom Jazz nicht auch eine Haltung zu lernen? Jazz nich tals Musikrichtung, sondern als Grundhaltung.
Dass man den Moment gelassener angeht, „laid back“ musiziert, das ist mir wichtig geworden. Auch dass nicht jede Note zusammen sein muss, so wie in einem Streichquartett mit Mozart und Schubert. Da bin ich viel freier geworden. Die Idee ist manchmal wichtiger als die Perfektion. Früher konnte ich mit einem Jazzmusiker, der keinen „schönen Ton“ hatte, wenig anfangen. Das hat sich geändert. Es geht um die Geschichte, und die darf auch mit raueren Tönen erzählt werden.
Danke für das Gespräch!