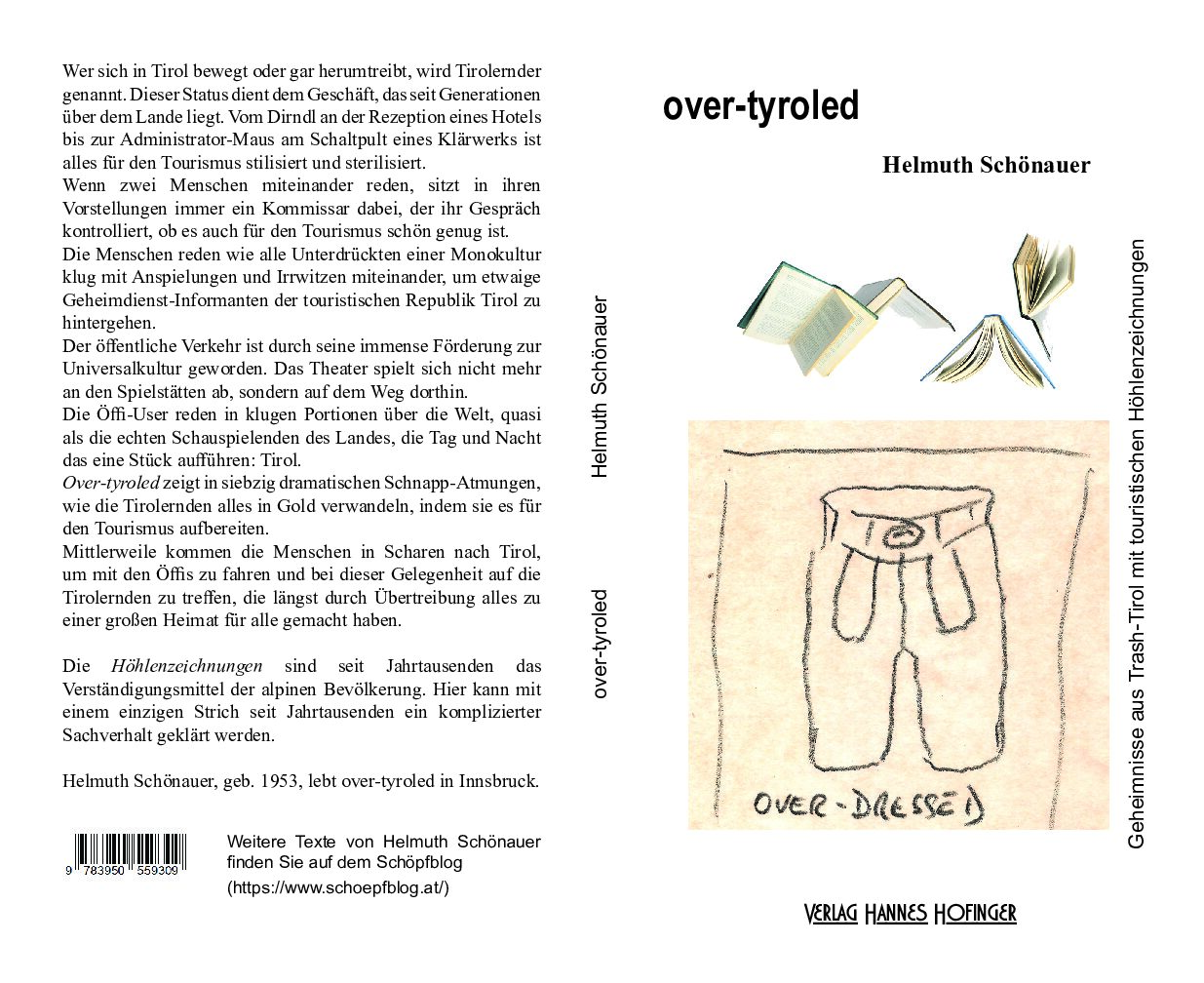All that Jazz
In „La La Land“ ist viel von Liebe die Rede. Von Sehnsucht und von Träumen. An letzteren sollte unbedingt festgehalten werden, sonst gibt man seine Ideale auf, erkennt sich selbst am Ende nicht wieder und tut Dinge, bei denen man ein Gefühl der absoluten Entfremdung hat. Dann hilft es nur noch, die richtige Musik zu hören, sich dadurch daran zu erinnern woran man einst geglaubt hat und sich wieder darauf zu besinnen, dass letzen Endes alles gut gehen wird, wenn den Träumen und Zielen nur leidenschaftlich genug gefolgt wird.
Verfeinert wird diese mäßig aufregende Geschichte mit einer kalkulierten Überdosis Nostalgie. Fred Astaire, ich höre dich steppen. In bester postmoderner Tradition wird zitiert, verfremdet, ironisiert. Welch wunderbarer Einfall, dass Sequenzen, die ansonsten mit allzu kitschigen Dialogen ausgestattet werden würden, auf sich selbst Bezug nehmen. Im Film sprechen die Protagonisten die eigentliche Hässlichkeit dieser Kitsch-Szenen an. Überhöhung nimmt auf Überhöhung Bezug und spottet ein wenig darüber.
Der Film wäre aber nicht aus der Feder von Damien Chazelle, wenn er nicht letzten Endes hauptsächlich den Jazz im Sinn hätte. Bereits 2014 ließ ebendieser Chazelle in „Whiplash“ seinen Protagonisten leiden. Wer Jazz spielen will, muss eben durch die Hölle gehen. Wer ein guter Schlagzeuger sein möchte, hat sich zu unterwerfen und gnadenlos bis zum Umfallen zu üben.
Der Pianist Sebastian hat es in „La La Land“ nicht wirklich leichter. Er muss sich zwar nicht gegen sadistische Lehrer durchsetzen, dafür aber gegen ignorante Bar-Besitzer. Seine free-jazzigen Improvisationen finden wenig Anklang. Seine Leidenschaft wird nicht honoriert. Seine Träume zerplatzen anfänglich an der Trägheit und Ignoranz seiner Geldgeber und Zuhörer.
Mia hat es nicht leichter. Sie möchte in Los Angeles Schauspielerin werden. Und nicht nur sie, sondern unzählige andere junge Frauen auch. Die Castings laufen wenig erfreulich, zumindest aber in der Liebe hat sie Glück und kommt mit dem hochtalentierten, wenngleich romantischen und notorisch an Geldnot leidenden Sebastian zusammen. Dieser bringt die ursprüngliche Jazz-Hasserin dazu Jazz zu mögen. Jazz sei Kommunikation und anno dazumal in New Orleans die einzige Form für Menschen mit verschiedenen Sprachen gewesen, miteinander zu kommunizieren.
Träume sind stärker
Gerade diese Kommunikation spielt im Film keine zentrale Rolle. Statt zu reden wird viel lieber getanzt oder gesungen. Vorangetrieben wird der Film von einfachen, aber effizienten motivischen Wiederholungen. Sehnsuchts- und Traummelodie natürlich inklusive. Immer wenn diese besagte Melodie erklingt wird an den eigenen Lebensentscheidungen gezweifelt, ganz viel taggeträumt und ganz generell die Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation zur Sprache gebracht. Wie hatte es nur so weit kommen können, dass sich die beiden Träumer zeitweise so extrem weit von ihren Träumen entfernten? Die Musik ist dann, obwohl elegisch und zart, lautstarke Anklage und Erinnerung, dass es doch bitteschön wirklich anders gehen muss.
Im Notfall stellt sich der Erfolg nämlich sogar ein wenn man einen Jazz-Club aufmacht. Die Leidenschaft muss dazu halt einfach stark genug sein. Das merken die Leute und strömen sodann in Scharen in den neuen, coolen Club, der ein so dringend notwendiges Gegengewicht zu all den seelenlosen und unaufrichtigen Bars und Clubs bildet. Da darf es dann sogar, natürlich nur in homöopathischen Dosierungen, der verpönte, kopflastige Free-Jazz sein.
Überhaupt ist dieser Jazz ja eine Musik für Träumer, Eskapisten, Step-Szenen-Apologeten und Scat-Gesang-Liebhaber. Damit ist klar, dass er sich bestens für die Untermalung der etwas zu bunten und halt wunderbar-pathetischen Bildern von „La La Land“ eignet. Man nehme eine große Hand voll Nostalgie, etabliere zwei Träumer in den Titelrollen und garniere das mit ein wenig Jazz und schönen Streicher-Arrangements. Dazu gebe man eine handvoll Klugheit und Informiertheit und lasse den Film über Filme reflektieren. Fertig ist das postmoderne Potpourri für Arthaus-Film-Möger.
Aber irgendwie, seien wir uns ehrlich, ist dieses Postmoderne-Spielchen doch auch schon wieder over and out. Echte Gefühle dominieren zunehmend. Aufrichtigkeit. Authentizität. Gefühle dürfen nicht zitiert werden, sondern müssen sich im Augenblick ereignen und den Zuschauer mitnehmen. Emma Stone bemüht sich in „La La Land“ redlich diesem Anspruch gerecht zu werden. Allein schon ihre sich mit Tränen füllenden Augen könnten die Krise der Postmoderne überwinden.
Fazit
Der Jazz ist nicht tot, er riecht nur höchst komisch. Auch bei „La La Land“ werden keine Möglichkeiten zur Revitalisierung des Genres aus dem Zauberer-Hut hervor geholt. Sebastian, der sich in eine Pop-Jazz-Krawall-Band des Geldes wegen verirrt, verlässt diese Band bald wieder und geht dem guten alten Jazz in seiner Bar nach, die er sich doch noch leisten kann. Das träumen hat sich gelohnt, die Musik ist dadurch aber auch nicht besser geworden. Sie hat sich abermals dahin zurückgezogen, wo sie schon vorher war. Von Träumern werden diese kleinen Freiräume noch verteidigt. Andere Träumer besuchen solche Bars und zögern den Tod dieser Musik noch ein wenig hinaus.
Was will uns „La La Land“ insgesamt sagen? So genau weiß man es nicht. Sollen wir alle träumen, Jazz hören und dabei möglichst arm und unangepasst sein? Sollen wir dem Leben mit einem Lied auf den Lippen begegnen und aus der grauen Masse mit dem einen oder anderen Step- oder Tanz-Schritt ausbrechen? Gute Frage.
Ja, der Film unterhält. Aber werden hier nicht auch ernsthafte Fragen der Unterhaltung geopfert? Redet sich der Film nicht mehr als einmal zu oft darauf hinaus, doch letzen Endes nur ein zauberhaftes Musical sein zu wollen, das die Realität nicht abbildet sondern leichtfüßig und gut gelaunt transzendiert? Wenn er das möchte, müsste er Antworten parat haben. Er müsste andeuten, wie ein anderes Leben mit ganz viel Träumen gefüllt möglich wäre. Er müsste die Strukturen der Gesellschaft mitdenken.
So bleibt nur eine Dichotomie zwischen Traum und Wirklichkeit bestehen. Die Träume zerplatzen nicht an der Wirklichkeit, sondern erfüllen sich ebendann, wenn ihnen kompromisslos genug nachgegangen wird. Ganz so als hätte die Wirklichkeit Respekt vor radikalen Träumern und würde ihnen dann doch noch etwas Glück zugestehen.
Das alles ist schön. Und tatsächlich kann man seine Zeit schlechter verbringen als mit diesem über 2-stündigen Film, der einen einlullt, in Parallel-Welten entführt und in der Tat rein filmimmanent betrachtet keinen Augenblick langatmig oder zu lang ist. Nach dem Genuss der überwältigenden Bilder und der gelungenen Filmmusik bleibt aber Unbehagen, Leere und das Gefühl, dass dieser Film so viel mehr hatte sein können.
Titelbild: (c) BagoGames, flickr.com