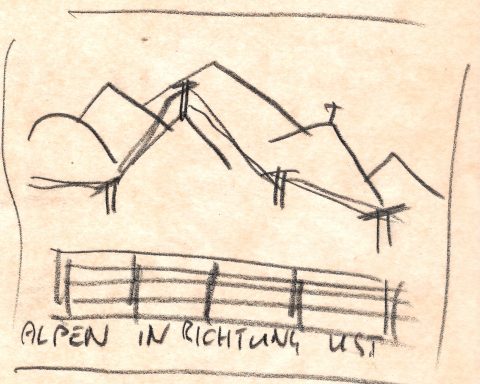Das Format „Album“
Das Hören eines gelungenen Albums braucht Zeit. Diese fehlt uns zunehmend. Zumindest finden wir jede Menge Ausreden dafür, dass wir Musik in vorgefertigten Formen und in vermeintlich appetitlich aufgeteilten Häppchen auf dem Weg zur Arbeit oder neben dem Frühstück hören. Sich nach getaner Arbeit mit guten Kopfhörern in seinen roten Ohrensessel hinzusetzen und ohne jegliche Ablenkung einfach nur Musik zu hören, erscheint fast wie ein Relikt aus bildungsbürgerlichen und längst vergangenen Zeiten.
Doch nicht nur die Hit-Maschinerie und die zunehmende Beschleunigung unseres Alltages spielen dem Album übel mit. Es ist auch die sinkende Qualität dieses Formats, die zu beklagen ist. Wenn man sich schon Zeit nimmt und seinen längst in den Dachboden abgestellten Ohrensessel wieder in der Funktion eines „Hör-Stuhles“ rehabilitiert, dann möchte auch der kulturkonservativste, selbsternannte Bildungsbürger nicht seine Zeit vergeuden. Zeit ist Geld. Zumindest ist Zeit aber zu kostbar, um sie mit lieblos aneinander gereihten Song-Sammlungen zu verbringen, die für sich beanspruchen ein „Album“ zu sein.
Julian Lage – Arclight
Es ist eine auf den ersten Blick banale Feststellung: Ein Album dauert eine ganz bestimmte Zeit. Es gibt lange Alben und es gibt kurze Alben. Wir haben uns damit abgefunden, dass die Dauer eines Albums variieren kann. Zu selten fragen wir uns aber, ob die Dauer eines Albums angemessen ist und ob diese in einem rechtfertigbaren Zusammenhang mit den Inhalten, den Erzählungen und Kompositionen des vorliegenden Werkes stehen.
Ein Album erzählt Geschichten. Das tut es mit der Hilfe von Melodien, Texten, Akkorden, Sounds und vielem mehr. Im besten Fall sind es nicht nur zusammenhanglose Kurzgeschichten, sondern Erzählungen, die ein großes Ganzes ergeben.
Ein besonders interessantes Exemplar ist mir erst kürzlich untergekommen. Es stammt aus der Feder des amerikanischen Gitarristen Julian Lage, der sich auf „Arclight“ zum ersten Mal mit einer elektronischen Gitarre vergnügt. Zumindest in voller Album-Länge und ausschließlich.
Julian Lage spielt in einer Liga mit Musikern, die sonst weitgehend gültige und apodiktische Genre-Grenzen nur mit äußerstem Unwillen akzeptieren und diese gekonnt, leichtfüßig und mit einem Lächeln im Gesicht virtuos überschreiten und sabotieren. Julian Lage lässt sich in einem Satz mit Chris Thile, Nels Cline oder Yo-Yo Ma nennen. Bluegrass, Country, Jazz, klassische Musik – und weiß der Teufel was sonst noch – finden sich in der Musik von Julian Lage aufs Friedlichste vereint.
Bitte nennt mir das ja nicht „Crossover“ – und findet bitte keinen anderen vollkommen blödsinnigen Begriff dafür. Denn Julian Lage bewegt sich auf seinem aktuellen Album „Arclight“ nicht zwischen den Stühlen, sondern baut sich kurzerhand mit enormer Musikalität seinen eigenen Stuhl.
Alles beginnt hier relativ harmlos mit „Fortune Teller“. Dieser Track ließe sich vielleicht noch als bluesiges Stück bezeichnen. Wenn, ja, wenn da nicht die merkwürdigen solistischen und improvisatorischen Ausflüge in benachbarte Musik-Felder wären. Mit „Persian Rug“ geht es so beschwingt weiter, dass man Julian Lage gar schon von Menschen auf der Straße umringt sieht, die von seiner Virtuosität begeistert sind.
Nein, diese Musik möchte nicht sperrig oder avantgardistisch sein. Und nein: Virtuos um der Virtuosität Willen ist hier rein gar nichts. Julian Lage hat es gelernt, obwohl noch keine dreißig Jahre alt, sein Können in den Dienst der musikalischen Imagination und der Melodien zu stellen.
Mit „Supera“ wird es später ein wenig karibisch. Scheint ja auch überaus gut zum sonnigen Gemüt von Lage zu passen. Wer sich Interviews mit ihm ansieht wird sich schwer damit tun, einen glücklicher wirkenden Menschen zu finden. Man muss sich im Fall von Julian Lage den Gitarren-Virtuosen ganz neu vorstellen: Nicht als verkrampften Saiten- und Bünde-Bezwinger, sondern als gelösten, vollkommen entspannten Musiker, dem alles von selbst in den Schoß fällt. Zumindest strengt sich Lage auf „Arclight“ ganz offenbar sehr an, um vollkommen unangestrengt zu wirken.
Mit „Activate“ wird noch einmal der eigenen Vergangenheit gehuldigt, in der sich Lage oftmals in komplizierte, immer aber hörenswerte Gitarren-Studien verstiegen hat. Das darauf folgende „Presley“ ist dann aber wiederum herrlich leichtsinnige Musik. Überhaupt sind diese vermeintlichen Gegensätze hier in Wohlgefallen aufgelöst. Lage kann von Melodieseligkeit in Freitonalität umschalten – innerhalb von Sekunden und wenigen Takten. Diese ganze Übung wirkt aber nicht konstruiert oder gar wie ein Bruch. Bei Lage sind es zwei Seite der gleichen Medaille die absolut logisch argumentiert, vorbereitet und umgesetzt sind.
Mit einer „elektrifizierten“ Version der Komposition „Ryland“, die auch schon auf der vorangegangenen Platte „World´s Fair“ zu hören war, beschließt er das Album. Es besteht insgesamt aus sieben Eigenkompositionen und fünf Fremdkompositionen, die sich Lage aber stets auf seine ganz eigene Weise erspielt und aneignet. Überhaupt wildert er in der Musikgeschichte, ganz ohne Scheuklappen und ohne Angst vor „alten“ Stücken. Die 20er und 30er Jahre sind für ihn ebenso interessant wie Anspielungen auf die eigene Gegenwart, etwa auf die klanglichen Experimente, die er mit Nels Cline auf „Room“ unternommen hat.
Fazit
Ja, das ist ein Album, wie ich es mir vorstelle. Dieses Album erzählt. Auf den ersten Blick von sich selbst und den damit verbundenen musikalischen Möglichkeiten. Aber dieses Album ist nicht aufdringlich oder gar geschwätzig. Mit einer Spieldauer von unter 40 Minuten hält es sich kurz und kommt auf den Punkt. Der Hörer bekommt Jahrzehnte von Musikgeschichte locker-fluffig aufbereitet geboten und den einen oder anderen Ausblick auf die Zukunft der Gitarrenmusik vorgesetzt.
Der sprichwörtliche „rote Faden“ von „Arclight“ ist somit leicht beschrieben: Julian Lage findet rote Fäden überhaupt erst, wo andere Genre-Grenzen und unüberbrückbare musikalische Unterschiede vermuten. Er zeigt, dass freie Improvisation und Blues- und Country-affine Stücke sich nicht im Geringen ausschließen.
Er erzählt davon, wie das so sein könnte: Wenn Virtuosen sich nicht mehr vornehmlich um ihre eigenen Virtuosität kümmern würden. Wenn die musikalischen Möglichkeiten offen vor den Musikern liegen würden und sich diese auch daraus zu bedienen wüssten anstatt nur nichtssagende Nischenmusik zu produzieren.
Kurzum: Ein Album wie dieses gibt einem nicht nur den Glauben an das Format „Album“ zurück, sondern lässt einen auch gelassen in Hinblick darauf werden, was die Gitarrenmusik der nächsten Jahre und Jahrzehnte noch alles bereithalten könnte. Ein Meilenstein ist mit diesem Album ja schon einmal geschaffen.
Zum Reinhören
Titelbild: (c) www.julianlage.com (Pressebild), Bearbeitung: Felix Kozubek