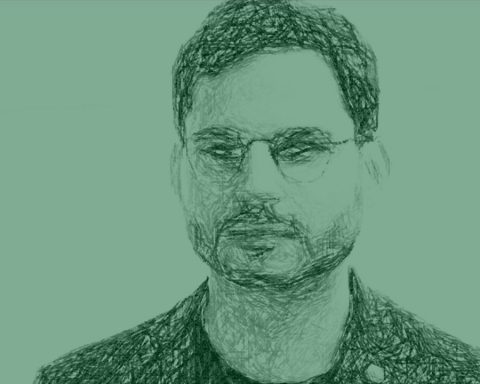Auch wenn gerade kein Jubiläum im Spiel ist, ist der Allerseelentag schon aus ästhetischen Gründen eine am Schopf zu packende Gelegenheit, um ein Requiem zu spielen. Und eine sakrale Stätte als Ort des Geschehens tut ihr Übriges zur gravitätischen Stimmung. Dieses Jahr war es der Dom zu St. Jakob in Innsbruck, der seine barocken Bögen und der Domchor, der seine Stimmen zur Verfügung stellte.
Das ist nicht nur schön in der Ausführung, sondern auch treffend. Ein Requiem ist sogar in der Postmoderne in erster Linie eine katholische Totenmesse, mit einem seit fast 500 Jahren fast unveränderten lateinischen Text.
Aber das Wunderbare an Mozarts Requiem: Man muss weder katholisch noch tot sein, um ihm etwas, um ihm viel abgewinnen zu können. Jenseitig ist es nur insofern, als immer ein klein wenig unbegreiflich bleibt, wie ein Mensch – darüber hinaus ein ziemlich junger Mensch von erst 35 Jahren – so komponieren konnte. Also: Jenseits dessen, was wir uns selbst, was wir den Menschen um uns herum an Tiefe zutrauen würden.
Dem Schicksal ergeben?
Das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, dass Mozart während des Komponierens schon krank war und fast bis zu seinem Tod daran schrieb, wobei er vom Sterbebett aus diktierte. Und schon gar nicht muss es heißen, dass er seinen Auftraggeber für den Sensenmann höchstselbst hielt oder ahnte, dass man ihn vergiftete und das Requiem deshalb für das eigene Begräbnis schrieb.
Natürlich ist das Seelenleben eines Künstlers von der Ausstrahlung des Werks und vom Eindruck des Rezipienten nicht völlig zu trennen. Aber er ist ein Werk wie das Requiem auch immer viel mehr als das.
Offensichtlich: Denn resigniert, schicksalsergeben oder elend ist es nicht. Neben den apokalyptischen Pauken und alttestamentarischen Trompeten sind es vor allem die leichten, lebhaften Mozart-Violinen, die den Klang definieren. Die Zauberflöte ist im selben Jahr entstanden – und das ist auch zu hören. Das Requiem schließt nicht ab und steigt nicht ins Grab hinunter, um sich zur letzten Ruhe zu legen. Es öffnet etwas.
Sogar der massive, undurchlässige Innsbrucker Dom kann mit irgendwie zu einem anderen Ort werden. Wenn das Requiem denn mit so viel Können und Hingabe gespielt und gesungen wird wie in diesem Fall. Neben dem (jetzt erwiesenermaßen) erstklassigen Domchor respektive Domorchester unter Christoph Klemm waren dafür noch vier Solisten verantwortlich.
Es ist wohl kein Werk, das man sich leicht aneignet. Andererseits kann man sich aber auch nicht dagegen wehren – nicht gegen die Spannung und auch nicht gegen die stellenweise Ruhe. Es fährt ein, bis in die trockensten Gebeine.
Viele andere Künstler haben sich davon inspirieren lassen – von Anton Bruckner, der in seinem eigenen Mozarts Requiem anklingen lässt, bis hin zu Evanescence, die in einer vom Metal angehauchten Version von „Lacrimosa“ um eine zerstörte Romanze trauern. Bruckners Requiem ist jedenfalls, in gemessenem Marschtempo, eine sehr deprimierende Angelegenheit. Mozart dagegen ist dramatisch, mitreißend, manchmal fast heiter. Auch das würde darauf hindeuten, dass er hier mehr verarbeitet als die Erwartung eines baldigen Todes.
Tröstlich auch vor der letzen Ruhe
So müssen wir auch Leonard Cohen nicht vorzeitig ins Grab schubsen, weil er auf seinem neuen Album „Hineni, hineni / I’m ready, my Lord“ singt. „Hineni“ sagt Abraham zu Gott, als er seinen Sohn opfern soll. Es ist nicht mehr und nicht weniger als die Einwilligung in ein Leben, das uns oft absurd vorkommt, bis zum Rande des Erträglichen.
Schon lange bevor wir sterben, kennen wir als Menschen abgrundtiefe Verzweiflung. Lange bevor alles vergeht, ist uns die Vergänglichkeit auch der kleinen und kleinsten Dinge manchmal ein giftiger Stachel im Fleisch. Lange bevor wir jemanden verlieren, ist uns schon sehr vieles verloren gegangen.
Wir können also auch aus unserem stabilen, aussichtsreichen, hellen Leben heraus Mozart hören und uns davon angesprochen fühlen. Wir können uns auch in die Trauer und die Verzweiflung hineinreißen lassen, und wissen, dass sie vielleicht auch ein ganz klein wenig unsere eigene ist.
Weil sie, zumindest bei Mozart, nicht alleine steht. „Der Finsternis das vorletzte Wort lassen“, sagte ZEIT-Redakteurin Elisabeth von Thadden kürzlich als Antwort auf die Frage nach dem Christentum. Vielleicht ist das spezifisch christlich. Vielleicht ist es aber auch spezifisch menschlich.
Und so kann es sein, dass sich im Requiem auch zeigt, was es heißt, in ein Leben als Mensch einzuwilligen. Auch wenn es einen zerreißt. Auch wenn es einen am Ende umbringt. Irgendwie kann man es ertragen – und wenn es nur deshalb ist, weil so etwas wie Mozarts Requiem möglich ist. Weil es ohne Implikationen, ohne Überbau ein unbegreifbar schönes Werk ist. Und weil, so wie die Violinen immer wieder über den schwermütigen Text triumphieren, etwas daran über die reine Trauer hinausdeutet.
In welchem Geist nun Mozart diesen letzten Geniestreich vollbracht hat, können wir nicht wissen und sollen es auch nicht. Wir können uns tief in dieses Requiem hineinbegeben und es erahnen. Und dann schweigen und es verinnerlichen. Denn, wie Søren Kierkegaard, einer der größten Mozart-Verehrer der Geschichte, meinte, liegt auch etwas Erbauliches in dem Gedanken, „dass wir vor Mozart immer unrecht haben.“
Und dann kann man eigentlich auch nur mehr – frei nach Kierkegaard – sagen: „Höre, höre, höre Mozarts Requiem!“ Sooft du kannst.
Live geht das natürlich besonders gut in Wien: Jeden Samstag von März bis Dezember wird Mozarts Requiem in der Karlskirche gespielt. Am übernächsten Samstag ist es auch im Münchner Herkulessaal zu hören.
Für diejenigen, die nicht so weit reisen möchten: Eine besonders schöne Aufnahme gibt es vom Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Sir Colin Davis, erschienen bei RCA.
Titelbild: (c) Kerstin Joensson