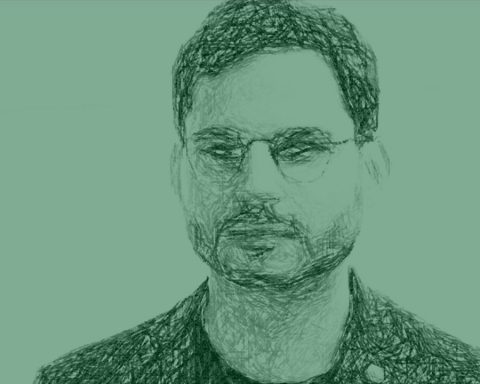Geräusch und Pop
Wo Geräusch ist, da ist auch das Rauschen nicht fern. Letzteres lässt sich als eine Art von akustischer Überinformation beschreiben. Der Zuhörer wird ganz bewusst mit „ozeanischen“ Sounds und Tonspuren überschüttet, sodass es ihm nicht mehr gelingt, einzelnen akustischen Informationen zu folgen.
Wo Geräusch ist, da ist immer auch das, was man gemeinhin als Lärm bezeichnet. Das englische Wort „Noise“ ist dabei mehrdeutig. Es meint sowohl den Lärm an sich und steht beim „White Noise“ in einer anderen Verbindung. Am besten übersetzt man „White Noise“ nämlich mit „Weißes Rauschen“. Die Verwandtschaft von Lärm, Geräusch und Rauschen lässt sich somit nicht leugnen.
Ein Festival, das sich „Heart of Noise“ nennt beschäftigt sich naturgemäß damit, wie Geräusch, Lärm und Rauschen zusammenhängen. Mehr noch will man hier zum Kern der Sache, zum Herzen dieser Frage vordringen.
Der Titel „Pop Life“ irritiert in diesem Zusammenhang. „Noise“, im Genre-Sinn und als „Verfahren“, ist nicht „Pop“. „Noise“ ist das Verfahren der Überforderung und der Herausforderung von Strukturen und Grenzen. Wenn es „rauscht“, dann fallen Grenzen. Dem „Noise“ wohnt also mehr als nur ein leichter Hang zur Grenzüberschreitung inne. Man bringt das Altbewährte zum „Rauschen“ und hat somit die Möglichkeit, aus einer festgefahrenen Situation der Unterkomplexität zu entfliehen.
Grenzüberschreitung
Den Gedanken der Transzendierung von Genre-, Kultur- und Identitäts-Grenzen mit den Mitteln des „Noise“ hatten wohl auch die Kuratoren des Festivals, Stefan Meister und Chris Koubek. Am Sonntag widmete man im Innsbrucker Hofgarten ganze drei Stunden drei Frauen aus Kairo, die sich der „geräuschaften“ Musik verschrieben haben. Besonders interessant geriet dort das Konzert der Musikerin Nadah El Shazly, die folkloristische Motive, Loop-Pedal, Laptop und Geräuschen sei Dank, in einen weit freiheitsversprechenderen Kontext überführte.
Tags zuvor verhandelte die Norwegerin Jenny Hval Identitätsfragen und überschritt, zumindest auf textlicher Ebene, Tabu-Grenzen. Das Thema Blut, vor allem Menstruationsblut, ist noch immer nicht im Mainstream der immer und überall zu behandelnden Themen angelangt. Der blonden Norwegerin schien das und das Vampirblut jedenfalls ein großes Anliegen zu sein. Musikalisch blieb sie im Rahmen des Vertrauten. Sie machte gefälligen „Avant-Pop“, der Geräuschflächen mit zum Teil grandiosen Melodien verquickte.
Freitags war das Festival hingegen von einem „klassischen“ Ambient-Noise-Act eröffnet worden. Fennesz, der sich auch schon in den Anfangszeiten des „Heart of Noise“ die Ehre in Innsbruck gegeben hatte, jagte auch heuer seine Gitarre durch diverse Effektgeräte und musizierte überhaupt sehr musikalisch mit Hilfe seines Laptops. Dazu trompetete Arve Henriksen elegisch-lyrisch und ließ sich auch zu der einen oder anderen klanglichen Radikalität hinreißen. Es machte durchaus Freude, ihrer Improvisationslust zu folgen.
Doch man muss beim „Heart of Noise“ auf vieles gefasst sein. Der nette und ansprechende Ambient-Noise-Schönklang von Fennesz und Henriksen wurde radikal mit „E.E.K. & Islam Chipsy“ gestört. Das klang wie Musik auf orientalischen Hochzeiten, verstärkt durch ganz viel Schlagzeug-Gepolter.
Dass man danach die Norwegerin Maja S.K. Ratkje auftreten ließ könnte man als kuratorischen Mut oder auch als Leichtsinn interpretieren. Nach ganz viel Getanze durfte jedenfalls bei der Norwegerin wieder am Boden gesessen und intensiv zugehört werden. Ratkje setzte ganz auf die Kraft ihrer Stimme und bewies ein hochsensibles Gespür für funktionierende uns sogerzeugende Tracks. Eines der kürzesten Sets geriet somit auch zum womöglich faszinierendsten Konzert des Festivals.
E und U
Weitere Highlights, wie eben Nadah El Shazly und Maja S.K. Ratjke, blieben rar. Selbstverständlich wurde ansonsten auch bei so manch anderem Act das erwartbare „Noise-Programm“ geboten. Auch dort konnte man sich, mit ein wenige Muße und Ausdauer, tief ins Ozeanische der akustischen Überinformation stürzen und dort eine gute, bewusstseinserweiterende Zeit haben.
Der rote Faden im Programm war, zumindest auf Papier, aber überdeutlich. „Pop“ und „Avantgarde“ sollten sich aneinander reiben. So lange, bis Unterscheidungen zwischen „E und U“ zerbröseln und obsolet werden. Keine leichte Bürde, die man den Acts da auferlegte. Die wenigsten wusste in ihrem Set eine Antwort darauf zu geben. Stattdessen wurde die Sache verlagert und die Frage nach „Pop“ und „Avantgarde“ durch die Zusammenstellung der jeweiligen Abende thematisiert. Banales und somit wohl auch „poppiges“ wie „“E.E.K. & Islam Chipsy“ traf etwa auf kompositorisch Anspruchsvolles bei Maja S.K. Ratkje. „Sowohl-als-auch Acts“ waren hingegen kaum zu finden.
Das war umso bedauerlicher, da Acts, die beim geistesverwandten „Donaufestival“ noch zu sehen waren und tatsächlich etwas in „Pop-Life-Fragen“ zu sagen und beantworten gehabt hätten durch Abwesenheit glänzten. So haben beispielsweise die norwegischen Ulver mit “ The Assassination of Julius Caesar“ einen Pop-Prog-Synth-Brocken jenseits von „E und U“ vorgelegt und das Experimentelle in das Einfache und Eingängige eingeschliffen und umgekehrt.
Auch der Label-Kollege Stian Westerhus arbeitet sich auf „Amputation“ an genau diesen ästhetischen Fragen ab und findet zu überzeugenden Antworten. Träumen könnte man auch noch von Thundercat beim „Heart of Noise“, der mit höchster Musikalität nicht nur Genre-, sondern Peinlichkeits-Grenzen überschreitet und zu einem mutigen, „poppigen“ und anspruchsvollen Gesamtkonzept gelangt.
Fazit
Es gab Highlights. Das Konzept war ansprechend. Der Rahmen des Festivals war insgesamt definitiv gelungen. Von der Bereicherung einige sehr gute Acts erlebt zu haben abgesehen bleibt aber das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. Das Festival hätte zugleich mehr „Pop“ als auch mehr „Avantgarde“ sein können.
Das implizite Versprechen Acts und Musiker zu präsentieren, die jenseits von „E und U“ und somit grenzenlos agieren und musizieren, hätte sehr viel öfter eingelöst werden können. Dann hätte man das pulsierende, pochende und rauschende Herz des Lärms noch deutlich lauter schlagen gehört.
Das Herz pochte jedoch leider eher zaghaft, wenngleich die Lautstärke der Konzerte zum Teil sehr hoch war. Es ist denkbar, dass man die Erwartungshaltungen des mittlerweile treu herangezüchteten Szene-Publikums nicht allzu sehr irritieren wollte. Es wurden zu wenige tatsächliche Grenzen überschritten.
Der „Patient“ „Heart of Noise“ ist zwar noch lange nicht tot und hat über die Jahre eine durchaus eindrucksvolle Wandlungsfähigkeit und Flexibilität an den Tag gelegt. Man wünschte sich beim diesjährigen Festival jedoch immer wieder, dass er mehr und intensiver leben und weniger verwalten würde. Vielleicht klappt das ja im nächsten Jahr. Potentiell machbar wäre es.
Titelbild: (c) Markus Stegmayr