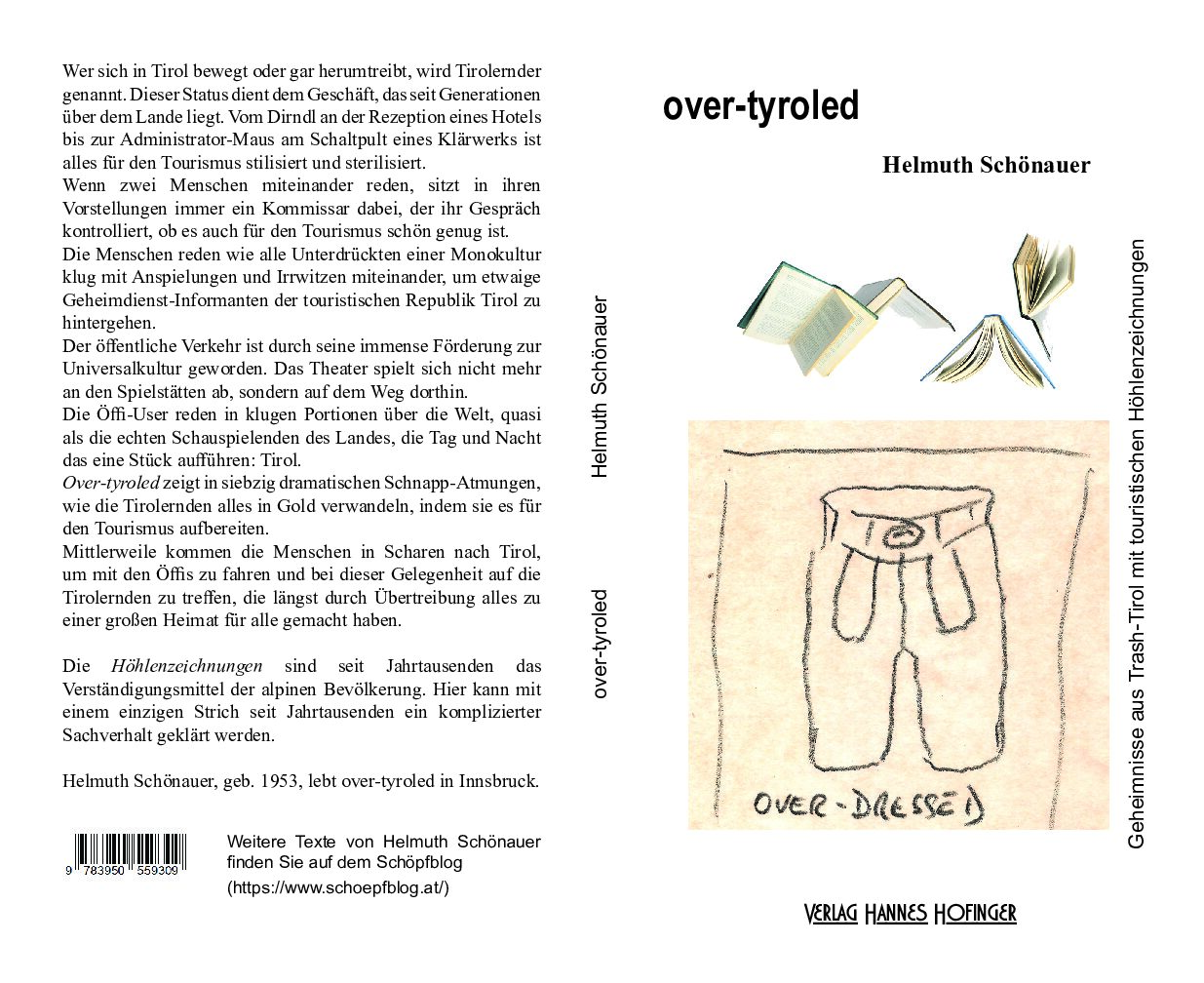Weltmusik
Wenn Herbert Pixner ruft, dann kommen naturgemäß die Massen. Ausverkaufte Tourneen sind der Beweis dafür. In der Innsbrucker „Bäckerei“ ging es gestern, obgleich gut besucht, etwas beschaulicher zu. Kein Wunder, denn nicht Herbert Pixner stand mit seinem umjubelten Herbert Pixner Projekt im Mittelpunkt, sondern der Messias der neueren Volksmusik die eigentlich auch ein bisserl Weltmusik ist, gab sich ganz als Label-Boss. Handverlesen präsentierte er drei Acts: Bayou Side, Undertaker´s Mom und Manuel Randi.
Ein sichtlich stolzer und entspannt wirkender Pixner führte in den Abend ein. „Alle drei Acts kommen aus Südtirol“, sprach´s abschließend und überließ die Bühne dem ersten Act „Undertaker´s Mom“. Ebendiese hatten sich dem „Dark-Folk“ verschrieben. Lieder über den Tod und die dunklere Seiten des Lebens wurden gespielt. Das klang ganz und gar nicht schlecht.
Mit dieser Ausrichtung fing man sich aber auch ein paar recht gravierende Probleme ein. Musiker aus Südtirol spielten eine Musik, die anderswo auch existiert. Eigenheiten und Lokalkolorit gab es, außer bei den dialektalen Ansagen des Frontmannes, so gut wie keine. Damit legte sich die Band mit Acts wie zum Beispiel Sixteen Horsepower oder Chelsea Wolfe an. Zwingende Argumente, warum man sich stattdessen nicht lieber „Songs of Love and Hate“ von Leonard Cohen auflegen sollte blieb man im Verlauf des etwa vierzig Minuten dauernden Konzertes außerdem schuldig.
Anders bei Manuel Randi, der sich mit ebenfalls mit der Musikwelt anlegte. Im Gegensatz zu Undertaker´s Mom blieb bei ihm aber jedweder Eindruck von Provinzialität aus. Man hatte an keiner Stelle das Gefühl, einen Abklatsch von etwas zu hören, das es irgendwo auf der Welt schon besser gibt. Virtuos spielte er sich durch diverse Genres, ließ Flamenco-Gitarristen ob seines Tempos alt aussehen, interpretierte sehnsüchtige Melodien um seinem Sehnsuchtsort Toskana Tribut zu zollen und gab auf der E-Gitarre glaubhaft den Hendrix.
Von Italien schwärmte er schließlich mittels spielfreudiger Band gar in Richtung Quentin Tarantino und Amerika aus. Randi hatte ausreichend Eigensinn und genug eigenen Stil, verfügte gefühlt über sämtliche „Dialekte“ der italienischen Musik und fühlte sich zugleich im Jazz der Gegenwart heimisch. Letzeres verriet er bereits vor dem Konzert, zumal „Lovers“ von Nels Cline als dezente Musikbeschallung in der Umbaupause benutzt wurde.
Die anschließenden Bayou Side verbrachten dann ähnliche Wunderdinge. Blues mit Jazz-Anklängen stand am Spielplan und ebendieser wurde leidenschaftlich und hochmusikalisch präsentiert. Ausgiebig erzählte Frontmann Hubert Dorigatti von seinen Amerika-Aufenthalten und davon, dass er dort auch schon gespielt habe. Sein Stolz ob dieser Tatsache war dem Sting-T-Shirt-Träger deutlich anzusehen. Da hatte sich ein Südtiroler in die weite Welt hinausgewagt und spielte eine Musik, die in seiner Heimat nicht traditionellerweise in der guten Bauernstube gepflegt wird.
Abermals traf in diesem Fall Welt auf Region. Provinz auf Weite. Eigener Ansatz auf weltweit bekanntes und gepflegtes Kulturgut. War das Blues mit dem Einschlag einer in Südtirol sozialisierten und aufgewachsenen Band? Mitnichten. Letztlich wollte man die relative Enge der Heimat mit den Mitteln des Blues und des Jazz weiten. Dabei wurden an mehr als nur einer Stelle die eigenen Wurzeln gekappt und zum Teil negiert.
Fazit
Es war ein unterhaltsamer Abend mit größtenteils hochkarätiger Musik und ebensolchen Musikern. Die „Leistungsschau“ des Labels „Three Saints Records“ ging also erfolgreich über die Bühne. Die eigentliche Intention des Labels oder zumindest des Abends bleibt aber ein wenig schleierhaft. Der Witz, dass Musiker aus Südtirol Dark-Folk oder Blues-Jazz spielen ist enden wollend. Musikalische Relevanz ergibt sich dann einzig damit, dass die jeweiligen Acts so gut sind, dass sie sich mit ihren Musiker-Kollegen weltweit messen können. Geht es aber nicht auch darum, dass lokale Eigenheiten und Feinheiten einen Einfluss auf die Musik haben sollten und sich „Heimat“ und „Welt“ auf kontroverse und kreative Weise begegnen? Diese Fragestellung sah man einzig bei Manuel Randi auf hohem Niveau verhandelt.
Musik braucht Welt. Regionale Unterschiede müssen immer wieder auf Spielarten treffen, die „exotisch“ oder nicht heimisch sind. Dadurch entwickelt sich Musik weiter. Durch diese Reibung entsteht oft Kreatives und Außergewöhnliches. Wird diese Konfrontation gemieden, dann kippt die Musik in Richtung „Welt“ und bügelt Widerständiges, Eigenes und das Besondere aus. Das ist dann Musik, die zwar die Welt absorbiert hat, die die Welt aber beim besten Wille nicht braucht, weil es schon zu viel vom Gleichen gibt. Insofern hat der Abend vorgeführt, wie es ginge oder wie es, im Falle von Undertaker´s Mom, eben nicht geht.
Titelbild: (c) Three Saints Records