In einer derzeit gerade gefeierten Werbung stirbt Opa. Zumindest täuscht er das seinen Angehörigen vor. Er sieht es als einzige Möglichkeit, um seine Verwandtschaft zu Weihnachten bei ihm daheim zusammenzubringen. Es klappt. Dass Opa ein Heuchler ist und mit den fiesesten Hollywood-Tricks arbeitet scheint dabei keine Rolle zu spielen.
Man könnte auch sagen, dass sowohl der Protagonist, als auch die Nebendarsteller als auch die Statisten in einer vor Pathos nur so triefenden Inszenierung gefangen sind, die mit den Emotionen der ZuschauerInnen spielt. Der Schnitt und die Montage der Bilder sind perfekt. Technisch einwandfrei und an Blockbustern geschult. Die Musik setzt an der richtigen Stelle ein, will berühren, rührt an. Das Zusammenspiel von Bild und Ton ist gekonnt.
Die Werbung funktioniert. Vor allem deshalb, weil sie mit Codes und Prinzipien arbeitet, die wir so verinnerlicht haben, dass wir quasi blind für diese geworden sind.
Wir können fast ohne Schwierigkeiten beschreiben, welche Szenen in Filmen uns berührt haben. Wir werden vermutlich sogar teilweise noch die Melodien und die Motive der Filmmusik im Kopf haben. Vielleicht schwirrt auch die eine oder andere Textzeile in unserem Kopf herum.
Auch Bilder haben sich festgesetzt. Bilder, die wir nicht mehr aus unseren Köpfen bekommen. Selbst dann nicht, wenn wir den Film schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen haben. Was uns aber schon schwerer fällt ist zu beschreiben, warum uns etwas berührt hat. Welche Blicke der Protagonisten sind dafür verantwortlich? Welcher Schnitt? Welche Bildmontage? Welche Kombination von einem ganz konkreten Akkord mit einem ganz bestimmten Bild hat uns angerührt?
Das Berührt-Sein folgt dem Prinzip der Distanzlosigkeit. Der Unmittelbarkeit. Der Distanz-Verlust und die Suspension der analytischen Ebene führt dazu, dass wir ganz im Hier und Jetzt der filmischen Narration aufgehen. Wir sind Teil davon, rezipieren zwar immer noch, tappen aber mit Lust in jede Falle, die uns der Filmemacher ausgelegt. Wir wollen berührt sein. Die Filmemacher und Werbefritzen wissen ziemlich genau, welche kulturellen Codes zum Distanz-Verlust führen.
Ich plädiere für eine Kultur der Distanz. Ich halte es mit John Cage, der sinngemäß einmal meinte, dass er sich zwar gerne von Musik berühren ließe, aber eben nicht drängen. Es ist auffällig, dass wir zunehmend in einer Kultur desr Distanzlosigkeit leben. Der Zuschauer will berührt und überwältigt werden. Erst wenn Tränen fließen und die Distanz absolut verloren geht, ist Musik oder eine Werbung wirklich gut.
Was ist dagegen zu sagen, wenn sich Menschen gerne zu Tränen rühren lassen wollen? Sehr viel. Eine Kultur der Distanzlosigkeit führt zu einer Gesellschaft, die Gefühle, Pathos und Angerührt-Sein über die rationale Distanz und analytische Fähigkeiten stellt. Eine solche Gesellschaft lebt im Dauer-Rausch der Gefühlsseligkeit. Diese Kultur tappt nur allzu gerne in die Falle zu glauben, dass derjenige, der die stärksten Emotionen hervorruft, automatisch auch der beste „Anführer“ ist.
Wir brauchen mehr Abstand. Wir brauchen mehr Kühle. Wir müssen uns einen Spot wie den, in dem Opa seinen Tod vortäuscht, mit der Gefühlskälte eines aufgeklärten, rationalen und kritischen Menschen ansehen. Wir müssen es ignorieren, dass uns Opa seinen Tod vortäuscht und sich sämtlicher Tricks bedient, um uns zu berühren und zu sich nach Hause bringen. Wir dürfen nicht heimkommen. Jetzt. Bevor es zu spät ist.


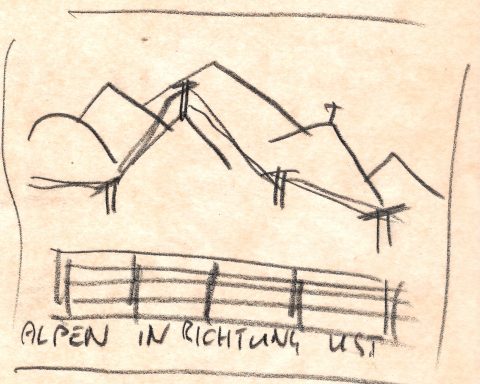



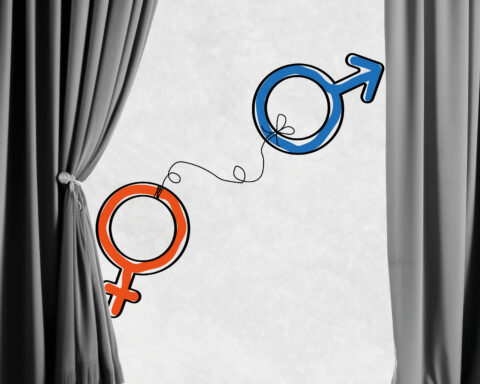





Genau lieber Markus Stegmayr.
Je ne suis pas Opa.