Denken macht einsam. Schreiben erst Recht. Damit ist nicht nur das Schreiben von Texten gemeint, das zumeist nicht in Gesellschaft und in geselliger Runde stattfindet. Mit dieser Feststellung ist der Prozess des Schreibens an sich bezeichnet.
Schreiben ist eine Bewegung. Nicht nur, weil man möglicherweise beim Schreiben leicht gebeugt sitzt und mit dem Stuhl dezent wippend Worte und Sätze formuliert. Schreiben ist vor allem deshalb eine Bewegung, weil Worte und Sätze etwas beschreiben möchten, das in seiner Ganzheit nicht beschreibbar ist.
Schreiben heißt Stilllegen-Wollen, heißt dem Begehren nach dem Festhalten-Wollen nachzugeben. Schreiben ist Sinn- und Wahrheitssuche. Schreiben ist eine Bewegung, die Bewegtes und Bewegendes auf den Punkt bringen möchte.
Indem man schreibt, verortet man seine Positionen. Im allerbesten Fall lockert man aber damit mögliche starre Positionen und dogmatische Meinungen. Schreiben heißt sich dem Möglichkeitsraum des „Auch-Noch“ anzunähern. Wer schreibt, setzt sein Denken in Bewegung und hat nicht den Konsens oder den Meinungs-Einheitsbrei im Sinn. Der laut denkende Schreibende vermisst, was auch noch denkbar und sagbar wäre. Trotzt dem bereits Gesagten neue Positionen ab.
Die Grundaufgabe eines Schreibers ist aus dieser Sicht heraus leicht benannt. Er formuliert aus seiner Einsamkeit, aus seiner mangelnden Zugehörigkeit heraus neue, für ihn denkbare und interessante Positionen. Diese sind lediglich strategisch. Sie stehen in der Funktion sein Denken und sein Schreiben anzuregen und in Gang zu setzen.
Indem man schreibt und diesen Prozess akzeptiert, akzeptiert man auch die Distanz und die notwendige Distanzierung zur Masse und zur Massenmeinung. Diese regt nicht an, sondern legt still. Sie lähmt das Schreiben und das Denken, anstatt es beweglich zu machen.
Wer in die Massenmeinung einstimmt, der denkt nicht wirklich frei. Wer schreibt und dabei nur wiederholt, was herdenhaft schon gesagt und geschrieben worden ist, der schreibt nicht wirklich.
Der käut wieder, der macht es sich bequem im Meinungs-Konsens. Der hat die Zustimmung und die Zugehörigkeit im Auge anstatt sich strategisch immer wieder in die Einsamkeit der eigenen Meinung zu begeben, die keine Zugehörigkeiten kennt. Schreiben verfolgt nicht zuletzt den Zweck, mögliche Zugehörigkeiten leichtsinnig und notwendigerweise zu sabotieren und abzuschütteln.
Nun kann man diese Position liberal nennen. Ohne klarer Haltung und ohne konkrete politische Heimat. Das mag sein. Vielmehr ist es aber eine Konsequenz, die sich aus dem Ernstnehmen des Schreibens an sich ergibt. Schließlich sollte die Freiheit des Schreibens unantastbar sein. Vor allem im Heute. Vor allem in Zeiten, in denen herdenhafte Massenmeinungen von politisch „linker“ und „rechter“ Seite grassieren und kaum mehr Nuancen und Zwischentöne möglich zu sein scheinen.
Titelbild: Amy Palko




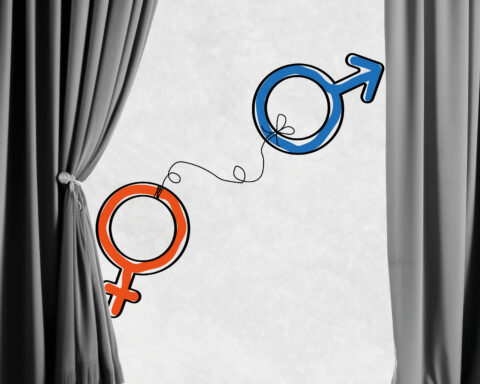



Lieber Markus, ich stimme mit dir darin überein, dass der Autor frei sein muss in seinem Denken und folglich in seinem Schreiben bzw. seiner Meinung unbedingt Ausdruck verleihen soll, aber per se gegen die Auffassung der Mehrheit zu sein, bedeutet noch lange nicht in seinem Denken näher an die Wahrheit zu kommen usw. Der Dichter, Schriftsteller, Journalist, Essayist als aufklärerischer Opponent ist mir zu romantisch gesehen! Ja, er/sie muss eine klare Position beziehen und diese auch behaupten, ungeachtet des Gegenwinds usw., aber eine begründete Meinung, Kenntnis, Ahnung von etwas kann man tatsächlich nur dann bekommen, wenn man auf die vox populi hört; ob man dann in den Chor mit einstimmt, oder eine Oktav höher oder tiefer singt, muss von Fall zu Fall neu entschieden werden, danke ich.
Lieber Martin,
auf gar keinen Fall möchte ich hier das Klischee des einsamen, weltabgewandten, genialen Schreibers reproduzieren! Ein völliges Abseits des Schreibenden ist ohnehin völlig undenkbar. Dennoch: Als Kolumnist versuche ich immer wieder, Gegenpositionen einzunehmen. Nicht, weil ich bewusst dagegen halten möchte. Vielmehr deshalb, weil ich die Komplexität der Diskurse schätze und manchmal den Eindruck habe, dass alles zu sehr nach Konsens strebt. Das halte ich dann durchaus für eine Aufgabe des Schreibende: Zu zeigen, dass man dieses Phänomen und dieses Ereignis auch noch anders und aus anderen Blickwinkeln sehen könnte.
Ja, das Eröffnen einer alternativen Perspektive ist bestimmt kein Fehler, lieber Markus, aber man sollte (wenn schon) daran glauben und die Opposition nicht „nur“ deswegen beziehen, damit es (wenigstens) eine Gegenstimme gibt. Die Glaubwürdigkeit eines Textes baut u. a. auf der Überzeugungskraft des Autors auf, und diese kann er/sie nur dann haben, wenn die vertretene Meinung auch wirklich und unbedingt die seine/ihre ist.
Lieber Markus, womöglich wäre es besser, im Zusammenhang deiner Standorterörterungen konsequenterweise auf politische Selbstverortungen ganz zu verzichten? Die Kategorie „liberal“ scheint mir in diesem Zusammenhang deplaziert, und dies nicht etwa, weil sie ein Synonym für fehlende Haltung und politische Beheimatung wäre, im Gegenteil: Das Spektrum liberaler Gesinnung reicht bekanntlich von nationalliberal und wirtschafts- bzw. neoliberal über liberalkonservativ bis libertär, entsprechend wird versucht, vermittels der Zuschreibungen „linksliberal“ und „rechtsliberal“ zumindest grob zu differenzieren, womit wir aber wieder bei der von dir beklagten klassischen Dichotomie wären. Was du meinst, ist natürlich die nicht politologische, sondern kulturelle Libertas, das ist mir schon klar. Gleichwohl scheint mir eine Charakterisierung der von dir vertretenen Sichtweise als „freidenkerisch“ passender (wiewohl der Begriff seine Wurzeln im engeren Sinne im atheistischen und religionskritischen Denken hat, was für wahrhaft unabhängiges Denken aber auch keine schlechte Voraussetzung ist), noch besser geeignet aber, und das wäre nun mein Vorschlag mit Blick auf dein Anliegen, Gegenstandpunkte zum jeweiligen Mainstream, zum je hegemonialen Diskurs einzunehmen, wäre die anspruchsvolle und aufklärerische Selbstcharakterisierung als „Dialektiker“!