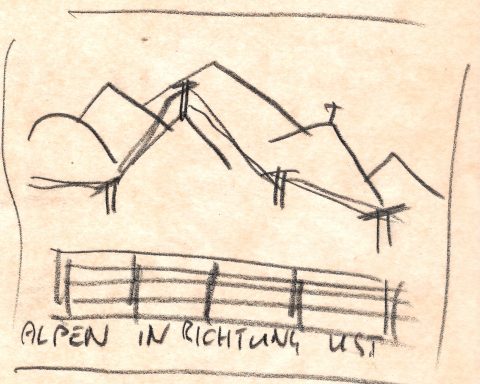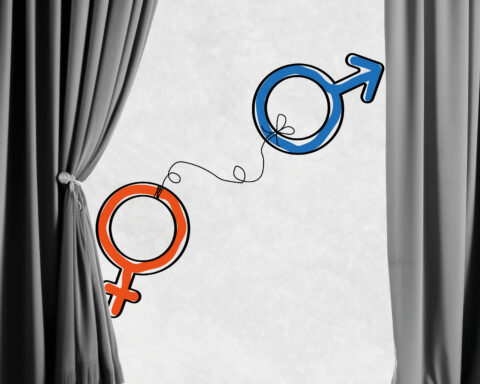Wir haben gewonnen. Bilder von feiernden Menschen flattern über die sozialen Netzwerke ins Haus. Berichte von Menschen, die sich in den Armen liegen, machen die Runde. All das wird auch noch untermalt von schwungvoller Musik. Später gibt es Konzerte. Wichtige und weniger wichtige Leute halten Schilder mit der Aufschrift „Danke“ in der Hand und in die Kamera. Diese sind in einem schönen Gelb gehalten. Das gibt Hoffnung.
Sogar aus der Ferne kann man die Aufbruchsstimmung spüren. Die Euphorie der Bilder müsste sich an sich auf jeden Betrachter übertragen. Nur auf mich wirken sie nicht. Ich bin von mir selbst angewidert. Meine Äquidistanz kotzt mich an. Statt zuhause zu sitzen und mich über Personen zu ärgern, die seit Wochen bei fast jedem Bild in der ersten Reihe stehen und ihr Engagement somit etwas zu sehr zur Schau stellen, sollte ich dabei sein. Es geht um alles. Wir haben noch mal Glück gehabt. Wir sollten feiern. Ich sollte feiern.
Etwas hindert mich daran, mitzufeiern. Ich weiß nicht, wer dieses „Wir“ ist. Und wo und wie ich mich in dieses Wir einfügen sollte. Strategische und pragmatische Teilnahme statt Befindlichkeiten und Reflexion? Möglicherweise eine Option. Es gelingt mir nicht. Wo wir war, muss wieder ich werden. So schießt es mir durch den Kopf.
Die feiernden Menschen geben mir nicht Hoffnung. Sie beunruhigen mich. Sie machen implizite und explizite Ausschlüsse sichtbar. Wer sich angesichts einer damals noch möglichen Präsidentschaft von Norbert Hofer unwohl fühlt, zugleich aber auch nichts mit Menschen zu tun haben will, die gelbe Schilder in die Kamera halten und in eine maßlose und irrationale Euphorie verfallen, wird ausgeschlossen. Ganz sicher nicht faktisch und handfest. Aber diskursiv und in einem spürbaren Macht- und Hierarchieblock.
Wo Offenheit für verschiedenste Identitäten und Ich-Konstruktionen war, hat jetzt das nicht näher bestimmbare „Wir“ das sagen. Strategisch? Temporär? Wird es nach der Wahl, nachdem dieses „Wir“ einen knappen Wahlsieg für sich verbuchen kann, wieder zerfallen und sich wieder zu seiner eigentlichen Heterogenität bekennen? Wo dieses wir war, sollte wieder „Ich“ werden. Nicht im Sinne einer Ansammlung von egoistischen Personen. Aber im Sinne einer Ansammlung von Individuen, die sich nicht auf einen Nenner bringen lassen.
Ich wünsche mir, dass das passiert. An diesem Ort. An anderen vergleichbaren Orten. Ich wünsche es mir für die Kunst ebendort und anderswo, die sich bewusst sein sollte, dass sie eben Kunst ist. Und keine Politik. Sie hat keine eindeutige politische Rolle.
Gute Musik ist aufklärerisch, stellt Dinge in Frage, fordert Offenheit ein, wo sich Diskurse und Weltanschauungen verengen. Wenn die Gefahr besteht, dass Musik zur bloßen Beschallung von multi-kulturellen Partys degradiert wird und ihr Wert vor allem darin besteht, dass sie Verständigung von verschiedenen Kulturen befördert, dann ist sie in ihrem Kunst-Sein massiv beschnitten und eingeschränkt.
Musik ist kein Sozialprojekt, vor allem keine Untermalung für etwaige Wahlsiege eines „Wirs“. Musik schafft es, aus einem konstruierten und problematischen „Wir“ aufgeklärte Individuen zu machen, deren „Ich“ sich kritisch reflektierend bekennt und wenn nötig auf Distanz zu einem ausschließenden und Absolutheit einfordernden „Wir“ begibt.
Wo einst „Wir“ war, verstanden als eine unhinterfragte Zugehörigkeit zu einer gewissen Gesellschaftsschicht, ist dank Kunst und Musik ein „Ich“ geworden, das sich seine Zugehörigkeiten aussucht, kritisch und skeptisch mit diesen umgeht und sie gegebenenfalls verwirft.
Dieses „Ich“ ist zuhause geblieben und hat das „Wir“ feiern lassen. War von sich selbst angekotzt und angewidert. Es fragte sich, was zur Hölle mit ihm bloß los sei. Jetzt hat es mehr Klarheit. Im Schreiben kann das „Ich“ sich selbst verorten, zumindest für ein paar Augenblicke.
Hier geht es zu den vorherigen Folgen von "Kleingeist und Größenwahn".