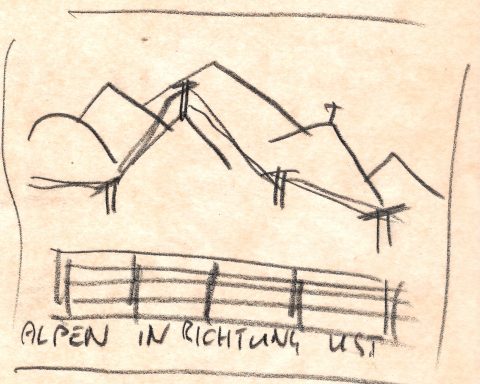Es begann mit einem Begriff, der so gar nicht in die laute Welt der Social-Media-Diskussionen passt: Textimmanenz. Selbst der Verwender dieses Begriffs, Klaus Nüchtern, traut ihm nicht ganz. So stellt er diesem Begriff einen Zusatz zur Seite. Er schreibt von der „keuschen“ Textimmanenz.
Er merkt an, dass „aufmerksamkeitsökonomische Alertheit und literarische Qualität zwei verschiedene Paar Schuhe sind“. Selbst tendiert Klaus Nüchtern zur Qualität. Zu Autorinnen, die zwar in den Seitenblicken Formaten nicht vorkommen, dabei aber halt wenigstens keinen Kitsch oder selbstverliebtes Generationsgeraune bieten würden. Was danach geschah ist bekannt.
Angesichts der Entwicklungen der weiteren Diskussion wünscht man sich mehr „keusche Textimmanenz“. Und träumt von einer Welt, in welcher der Erörterung, welche Zugänge zu Texten möglich sind und wie sich Qualitätsmerkmale festmachen lassen, der Vorzug gegeben wird.
Fast zeitgleich wird über das Konzert von Keith Jarrett diskutiert. Der Schriftsteller Clemens Setz wohnte dem Konzert in Wien bei und formuliert „Wie ich Keith Jarretts Feind wurde“. Jarrett, für sein Verhalten berühmt-berüchtigt, machte seinem Ruf auch in Wien alle Ehre. Unter anderem sagte er dort gleich zu Beginn: „Ich spiele nicht eine einzige Note auf diesem Klavier, bis die zwei Personen, die Fotos gemacht haben, das Gebäude verlassen haben!“ Im Laufe des Konzertes wird sich Jarrett noch wie ein „Tier im Käfig“ fühlen, dem Publikum vorhalten dass es Schuld sei, dass er gar nicht wirklich da und bei der Sache war. Selbst Schuld quasi, weil sie seine Regeln nicht akzeptiert hätten.
Der Text von Setz wiederum veranlasst den Autor Alban Nikolai Herbst ausführlich zu widersprechen: „´Der Held meiner Jugend´, das ist Identifikation, ich bin wie er. Hiergegen brachte Jarrett zum Ausdruck: Nein, ihr seid nicht ich, ich bin nicht ihr, aber wenn wir uns gemeinsam konzentrieren, ohne freilich daß wir wissen, wohin die Klangreise geht, dann haben wir alle gemeinsamen Anteil, gehören wir alle der Musik und werden vielleicht, nur aber eben dann, in ihr einig.“ Herbst verteidigt die hohe Kunst von Jarrett und beharrt darauf, dass der Zugang von Setz eben der Zugang zu „Pop“ sei, eine Heldenverehrung.
Zu dieser Diskussion kann man sich auf verschiedenste Weisen verhalten. In ihrer ganzen Komplexität ist sie außerdem hier nicht skizzierbar. Eines wird aber deutlich: Setz verhält sich beleidigt, enttäuscht. Sein „Held der Jugend“ hat ihm keine Identifikationsfläche geboten.
Setz zieht seine Konsequenzen. Er weigert sich spätestens seit diesem Bruch tatsächlich über die Musik von Jarrett zu schreiben. Während Herbst nach den Gründen und Bedingungen der Kunst von Jarrett sucht, nennt Setz seine Musik „zynisch“ und schreibt: „Ich hatte begriffen: Das hier ist nicht für uns. Es ist eine Aufnahme. Wir sollten nicht hier sein. Wir stören.“
Clemens Setz hätte man eine „keusche Textimmanenz“ ans Herz legen sollen. Nun ist Musik kein Text, aber sie kann analysiert, beschrieben und in ihrer Bedingtheit hergeleitet werden. Damit gelangt man, quasi mit einem intertextuellen Verfahren, von einem „Text“ zum nächsten, von einem Werk zum Anderen.
Spätestens dadurch würde deutlich werden, dass sich Einflüsse und Verbindungen zu anderen Werken in den Solo-Konzerten und -Aufnahmen von Jarrett finden lassen, ihm aber vorrangig daran gelegen ist, singuläre Momente zu schaffen, die diesen „intertextuellen“ Faden kappen. Es geht ihm um persönlichen Ausdruck, um Individualität. Und ja: Um die Pflege seines eigenen Genies, das in einer tendenziell zum Konsens und zur Gleichmacherei neigenden Gesellschaft aneckt. Jarrett inszeniert sich als derjenige, der keiner von uns ist und der aufgrund seiner langen, intensiven Suche nach neuen musikalischen Möglichkeiten Ruhe, Stille und Respekt einfordert.
Statt sich über das Werk von Jarrett und dessen augenblickliche und veränderliche Manifestation in der Konzert-Situation Gedanken zu machen, wechselt Setz vom „Text“ zum „Kontext“. Vor allem aber hat er, wenn auch möglicherweise ungewollt, die Aufmerksamkeit der Online-Leser im Blick. Eine Schmähschrift über die Eigenarten von Keith Jarrett verkauft sich besser als eine werkimmanente Analyse dessen, was musikalisch an diesem Abend wirklich passiert ist.
Hätten wir nicht spätestens nach der unsäglichen Kontroverse um Sargnagel und Glavinic dazu übergehen müssen, Text-, Werk- und Kunstimmanenz einzufordern? Hätten wir nicht stattdessen über die literarischen und sprachlichen Unterschiede zwischen den von Klaus Nüchtern genannten Autorinnen diskutieren sollen? Das alles gewissenhaft, sachlich und ja – ein bisschen langweilig und wenig online-tauglich.
Wir haben kapituliert. Vor den Mechanismen einer nach schneller Aufregung und Erregung gierenden Online-Meute. Auch die Überschrift in dieser Kolumne belegt das. Es wird insgesamt immer weniger über Kunst geschrieben. Auch in Zukunft wird der Begriff „sprechender Rollmops“ mehr Aufmerksamkeit generieren als das Versprechen, demnächst eine ausführliche Werkanalyse der letzten Keith Jarrett Einspielungen vorzulegen.
Das ist bedauerlich. Aber womöglich werden wir damit leben müssen. Und mit lauten Überschriften zu leisen Themen heranführen.
Hier geht es zur vorherigen Folge von "Kleingeist und Größenwahn".