„Daumen hoch für eine kurzweilige und schwer groovende Performance!“ Diese lobenden Worte hatte ein österreichisches Metal-Fachmagazin einer heimische Band zugesprochen. Dem Headliner dieses Abends wurde gar folgender Satz auf den Leib geschrieben: „Wer heute nicht anwesend war, hat heute ein Stück tiroler metallische Clubgeschichte, jedenfalls aber ein tolles Konzert eines brandheißen Newcomers verpasst“! Zwischen diesen Zeilen stehen Worte zur Einschätzung der Konzert-Lage und Sätze wie „ihr Pulver hat die Band noch nicht verschossen […]“.
Zeitgleich wurde anderswo, ausgehend vom selben Konzerterlebnis, über den aktuellen Zustand der „harten Musik“ spekuliert. Sinnbildlicher und konziser kann die Differenz der Zugangsweisen nicht dargestellt werden. Während bei eingangs zitiertem Magazin „Clubgeschichte“ verpasst wurde, wurde beim AFEU aus meiner Feder ein Konzert zum Anlass genommen, Sinnkonstruktionen aufzustellen.
Dahinter stehen einige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Lohnt es sich einen „Fachdiskurs“ über Bands zu führen, die man selbstverständlich in den zahlreichen Mini-Nischen des Über-Genres Metal verorten kann oder ist einem das Genre erst einmal egal? Analysiert man überhaupt die Musik im Detail und hat man überhaupt das Rüstzeug und Werkzeug dazu zur Verfügung? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, sich begrifflich und diskursiv einem Konzert-Ereignis anzunähern und es als Manifestation von vorherrschenden Strategien, Diskursen und Tendenzen zu verstehen?
Ein Gespräch mit einem österreichischen Journalisten brachte mich diesen Fragen sehr nahe. Er meinte, dass ein Kollege von ihm, dessen Name selbstverständlich auch ungenannt bleibt, Musik einfach nicht fühlen könne. Dieser würde zwar sehr gute Analysen schreiben, weil er Musikwissenschaftler sei und natürlich exakt wüsste, was auf der Bühne in jedem Moment vor sich ginge. Letztlich würde aber die Begeisterung fehlen. Ich stimmte ihm zu und meinte vor allem sinngemäß, dass wir schließlich von einer Art „Vermittlungsarbeit“ sprechen. Die eigene Begeisterung muss als Motivation und Anreiz für Leser und Publikum dienen, sich überhaupt mit anspruchsvolleren Spielarten aus der weiten Welt der Musik zu beschäftigen.
Das alles führt dazu sich zu fragen, für wen mit welcher Intention auf welche Weise man überhaupt schreibt.
Es ist natürlich das Wesen eines Fachmagazins, für ein Fachpublikum zu schreiben. Wer die Zitate im ersten Absatz dieser Kolumne liest der bemerkt schnell, wer das Fachpublikum dieses Magazin ist. Es richtet sich nicht vorrangig an ein Fachpublikum, das seinen Metal aus musikalischer und musikwissenschaftlicher Sicht aufs genaueste analysiert und fachmännisch dekonstruiert haben möchte. Es richtet sich an die Szene. An den Zusammenhalt und die Zusammenhänge ebendieser.
Bands werden in Kontexte gestellt, Vergleiche werden angestellt, Einschätzungen werden abgegeben, welches Konzert man auf gar keinen Fall hätte verpassen sollen, weil einem sonst ein Mosaik-Steinchen fehlt, wenn es darum geht, sich ein einheitliches und ganzheitliches Bild der nationalen und internationalen Metal-Szene zu machen. Das hier angesprochene Fachpublikum ist also nicht insofern Fachmann und Fachfrau, dass es aus lauter ambitionierten Musikerinnen und Musikern bestünde. Es ist Fachpublikum in der Hinsicht, dass es sehr viel auf Konzerte geht und wissen möchte, wo man als Teilhaber einer Szene wirklich sein muss oder hätte sein sollen.
Das radikale Gegenbeispiel eines solchen Ansatzes wäre der Ansatz des „einsamen“ Kritikers, der sich nicht als Teil einer Szene sieht und dabei ganz kühl und fachlich korrekt Konzerte beschreibt und einschätzt. Er würde wissen, dass dieser Riff schon tausendmal gehört wurde, er würde sich über langweilige Akkord-Progressionen -und -Variationen auslassen. Er würde sich fragen, warum die harmonisch reichhaltige Pop-Musik der 60-er einer zunehmenden Eintönigkeit und Einfallslosigkeit gewichen ist.
Beide Positionen sind letzten Endes wenig erstrebenswert. Die Position des Schreibens aus der Szene für die Szene schafft hermetische Diskurse, die mehr und mehr Ausschlüsse schaffen. Wer die in solchen Texten verhandelten Vergleichswerte und Bands schlicht nicht kennt, wird aus einer möglichen Anschluss-Kommunikation von vornherein ausgeschlossen.
Mögliche Diskussionen über die Substanz und die Essenz der musikalischen Darbietung werden von der Überfülle und dem Ballast des „Szene-Diskurses“ übertüncht. Jeder, der sich anmaßt, die Qualität der Darbietung zu kritisieren, wird damit mundtot gemacht, dass er sich in der Szene nicht auskenne und erst einmal Band XY hören solle, bevor er eine solche Einschätzung abgebe.
Der „szene-kritische“ Rezensent hat hingegen mit gänzlich anderen Problemen zu kämpfen. Abgesehen von der letzten Bastion solcher Kritiken, den Print-Teilen der sogenannten Qualitäts-Zeitungen“, fehlen solchen Texten schlicht und einfach die Leserinnen und Leser. Texte die niemandem etwas schuldig sind außer dem eigenen Intellekt und der eigenen Unbestechlichkeit wenn es um ein fachmännisches Urteil geht, richten sich an eine amorphe und wenig exakt definierte Leserschaft, die womöglich in der vom Kritiker gewünschten Art und Weise gar nicht existiert.
Eine dritte Position, für die ich seit längerer Zeit plädiere, ist die Position der diskursiven Verortung jenseits von Szene-Beschreibung und nüchterner Musik-Analyse. Musik ist ein in sich geschlossenes System, keine Frage. Aber Musik ist auch politisch und kann nach seinen politischen Implikationen abgeklopft werden. Es lohnt auch, systemimmanent, vom Einzelnen aufs Ganze zu schließen und Rückschlüsse auf den Zustand einer ganzen Spielart von Musik zu ziehen.
Diese Position des Schreibens bietet Sinnkonstruktionen an und geht das Risiko ein, an manchen Stellen spekulativ zu sein. Aber zumindest wird hier potentiell der Raum für Diskussionen geöffnet. Tendenziell sind diese Texte nicht ausschließend und ausschließlich für Szene-Kenner oder Musikwissenschaftler geschrieben, sondern für diskussionsfreudige und diskursfähige Menschen mit Liebe und Begeisterung zu und für sehr viele verschiedenen Musikrichtungen ohne klare Szene-Verortung.
Einen Versuch ist es allemal Wert eine solche Position zu beziehen. Weil Schluss sein muss mit langweiligem Szene-Geschreibsel und leidenschaftlosem Musikwissenschaftler-Getue. Beides tut dem nicht gut, was wir eigentlich alle lieben: Der Musik.
Hier geht es zur vorherigen Folge von "Kleingeist und Größenwahn."


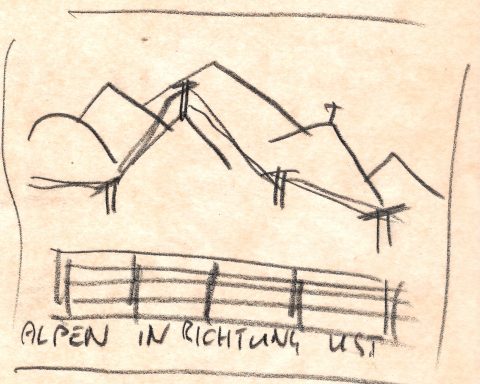

Ich bin geneigt, zuzustimmen, entscheide mich selbst als „Musikjournalist“ in der Regel für eine weitere Schreibzielsetzung, die ebenfalls und vor allem versucht, die Langeweile, die meiner Meinung nach das zentrale Problem der ganzen Über-Musik-Schreiberei ist, zu umgehen. Ich lese Konzertberichte nicht, um Musikerfachwissen oder Szenegeschwurbel zu lesen (allerdings auch wenig, um Diskussionsstoff für Meta-Gespräche über die Szene, das sozialpolitische Ganze oder ähnliches zu haben), sondern vor allem, um in Anlehnung an mir bedeutende Themen (wie eben bestimmte Band) unterhalten zu werden. Da Musikjournalismus aber doch auch immer wieder journalistischen Anspruch haben möchte, entstehen UN-unterhaltsame, beschreibende Beiträge en masse. Für viele/einige (?) Leser mag das auch interessant so sein. Ich möchte lieber eine Seite aus einem humorvollen Roman lesen, in den das Konzert eingebunden ist. Und deshalb schreibe ich vor allem spielerisch, lebendig, lustig und werfe nur teilweise Elemente aus den drei Schreib-Positionen ein, die dieser Artikel aufzeigt.
(Anderes, an dieser Stelle unwichtigeres Thema, gleicher Artikel – (leicht) überspitzt: Muss feulletonistisches Geschreibsel eigentlich immer so klingen, als wollte es all jene ausschließen, die keinen Hochschulabschluss in der Tasche haben? Wirkt schnell so, als wollte sich eine gar nicht so komplizierte Botschaft hinter möglichst komplizierten Worten verstecken, um für wichtiger gehalten zu werden. Funktioniert, aber ist nicht gerade angenehm!)
Gebe Ihnen völlig recht, was die Anziehung des Narrativen betrifft.
Aber re „feuilletonistisches Geschreibsel + Hochschulabschluss“: Man muss nicht komplizierter schreiben als nötig, aber gelesen werden Feuilletons wohl fast nur von Leuten, die gern und viel lesen. Die halten schon den einen oder anderen etwas komplizierter gebauten Satz aus, egal ob mit (wohl die Mehrzahl) oder ohne Abschluss einer tertiären Bildungsstufe.
Gerade von Markus Stegmayr war so ein Metatext überfällig, dessen Beiträge über die unterschiedlichsten Musikanlässe oft relativ (manchmal zu weit) ausholen, um einen Kontext für die „eigentliche Besprechung“ herzustellen. Das funktioniert für mich dort gut, wo daraus eine Erzählung wird (siehe auch Kommentar von J.S.), selbst wenn ich die Musiker:innen um die es geht bisher nicht kannte. Einen großen Vorteil des Online-Feuilletons sehe ich in der Möglichkeit, Hörbeispiele anzufügen, die man schon mal anhören kann, während man den Beitrag liest, und dabei eigene Höreindrücke mit der Kritik vergleichen.
Darf ich euch allen eine vierte Position vorschlagen?
Nämlich die musikwissenschaftliche Satire!
Siehe hier: http://www.stormbringer.at/livereports/2312/cannibal-corpse-krisiun-und-hideous-divinity-gore-not-core-weekender-innsbruck.html
und hier: http://www.stormbringer.at/livereports/2418/metaldays-2016-oder-was-haben-putin-porn-grind-professoren-und-pizza-gemeinsam-tolmin-tolmin.html
Feeback würde mich freuen. Wenn’s keines gibt, auch egal!