„Mit Portugal gewann die Musik“. So titelte gestern die österreichische Tageszeitung „Der Standard“. Diese Schlagzeile suggeriert, dass das keine Selbstverständlichkeit sei. Das ist erstaunlich bei einem Konzept, das den Wettstreit von Liedern bereits im Titel trägt.
Dabei ist wenig wahrscheinlich, dass sich Medien und Journalisten tatsächlich um die Qualität von Musik kümmern. Vielmehr ist augenscheinlich, dass sie dem Argumentationsstrang von Salvador Sobral selbst folgten. Nach seinem Sieg gab sich dieser lässig-unbeeindruckt und schwang sich dennoch Augenblicke später zu einer pathetisch-eindruckschindenden Kurzrede auf. Wir würden alle in einer Welt der „Fast-Food-Musik“ leben. Diese Musik hätte selbstverständlich keinen Inhalt. Vielmehr gehe es doch um die Gefühle, nicht um das „Feuerwerk“. Seinen Sieg sah er, nicht wenig selbstbewusst, als einen Sieg von „Musik, die etwas bedeutet“.
Um diesen jungen Musiker einordnen zu können muss man wissen, dass Sobral eigentlich Jazz-Musiker ist. Zumindest hat er in Barcelona Jazz studiert. Neben Jazz mag er wohl auch noch Fado und die Kenntnis des „Torch Songs“ darf man ihm ebenfalls unterstellen.
In diesem Musik-Umfeld ist es eine Selbstverständlichkeit, die Songs selbst zu schreiben und nicht auf schwedische Hit-Fabriken zurückzugreifen. Bedeutung kann nur durch Nähe erschaffen werden. Musik, die Gefühle ausdrücken soll muss das Innenleben des Interpreten abbilden.
Statt Oberfläche wird auf Innenschau und Tiefe geachtet. Das Siegerlied hat dann zwar nicht der Interpret selbst geschrieben, aber seine Schwester. Über den Gesundheitszustand des Sängers wurde außerdem im Vorfeld gerätselt. Ist eine mysteriöse Krankheit der Grund, warum seine Schwester ihm dieses Lied schrieb und warum es derart beseelt sang als ob es kein morgen gäbe?
Dazu muss erwähnt werden, dass ein weiterer Interpret des Abends sein Lied nicht aus der Song-Manufaktur abholte, sondern es direkt seinem Herzen entriss. Nathan Trent verarbeitet in „Runing on air“ eine kleine Lebenskrise. Beim Songcontest konnte Nathan, im Gegensatz zu Salvador, eher nicht punkten. Zwar mochte die Experten-Jury den Song lieber als das europäische Publikum. Letzen Endes reichte es aber nur zu einem 16. Platz. Es lässt sich also nicht sagen, dass es einen Überdruss gäbe, was Massenware-Musik betrifft und dass man ab sofort nur mehr „echte“ und selbstgeschriebene Musik hören wollte. Denn Massenware definiert sich nicht ausschließlich über den Herstellungsprozess, sondern über die Qualität.
So ist das, was Salvador Sobral in seiner Kurz-Rede als mögliche Kriterien für gute Songs vorschlägt höchst problematisch. Bedeutung generiert sich nicht aus der Verneinung der Merkmale und Eigenschaften heraus, welche den Prozessen der Bedeutungs-Auflandung entgegenstehen. Diese Prozesse definiert er als solche, die Bedeutungen überdecken, echten Emotionen entgegen stehen und die „bedeutende“ Musik verunmöglichen.
Doch die „verneinende“ Musik, die nah am Herzen des Interpreten ist, kann ebenfalls Massenware sein. Die Lieder von Salvador Sobral und Nathan Trent machen es deutlich. Salvador Sobral bedient sich bei seinem Song „Amar Pelos Dois“ tatsächlich einer ungewöhnlichen großen Bandbreite von Akkorden und Harmonien. Die Jazz-Pop-Fado-Ballade entwickelt dennoch einen erstaunlichen Fluss und bleibt beeindruckend eingängig, hörbar und anschmiegsam. Der relativ hohen, zumindest im Kontext Song-Contest, musikalischen Komplexität begegnet der Interpret mit einem Höchstmaß an Gefühl und Einfühlung. Dadurch leuchtet er den Song in seinen Facetten aus und umschifft sämtliche Kitsch-Fallen.
Nathan Trent hingegen wählt einen anderen Weg. Auch wenn der Song von ihm selbst geschrieben wurde ist er, zumindest in der jetzt vorliegenden Form, unauffälliges und unaufdringliches Radiofutter für die heimischen Mainstream-Radios. Trotz seiner stimmlichen Qualitäten und seiner absoluten Intonationssicherheit bleibt der Song blass und beliebig. Der Fundus, aus dem sich „Running on Air“ bedient, ist Massenware. Der Rahmen eines konventionellen Pop-Songs wird niedlich-nett und gut mitsingbar ausgefüllt, niemals aber auch nur herausgefordert oder gar in Frage gestellt.
Was sagt uns somit der Sieg von Salvador Sobral? Vielleicht tatsächlich, dass in Zukunft verstärkt die Lieder gewinnen, die aus dem Rahmen fallen. Das war auch schon in der Vergangenheit so, man denke etwa an die Hardrock-Band „Lordi“, die den Songcontest 2006 mit „Hard Rock Hallelujah“ für sich entschieden. Auch Alf Boier war mit einem Top-Ten-Platz vor einigen Jahren aufgefallen. Beide Acts setzten aber nicht auf die Art von „Bedeutung“, die Sobral meint. Sie setzten recht erfolgreich auf das Prinzip des „Anders-Sein“. Auch so lässt sich aus dem Rahmen fallen und in einer Art von Marktlogik auf erhöhte Aufmerksamkeit hoffen.
Sobral ist in dieser Logik ebenfalls auffällig geworden. Jedoch nicht mit Überspitzung, Übertreibung oder mit Ironisierung des Formats „Song Contest“. Vielmehr wurde seine Musikalität auffällig, die in Zusammenhang mit einem herausragenden Song ein „Feuerwerk“ der anderen Art entzündete. Gott bewahre uns davor, dass in Zukunft alle Interpreten mit ihren selbstgeschriebenen Songs antanzen. Das ist nicht der Trend, den Sobral auslösen sollte. Einmal Nathan Trent ist mehr als genug. Die Hoffnung ist aber aufrecht, dass durch seinen Sieg das Augenmerk von der Inszenierung zur „Sache an sich“ gelenkt wird. Der Blick nunmehr vom Kontext hin zum „Text“ schwenkt und die Bewertung sich vom Umfeld zur Musik hin bewegt.
Titelbild: (c) RTP, flickr.com

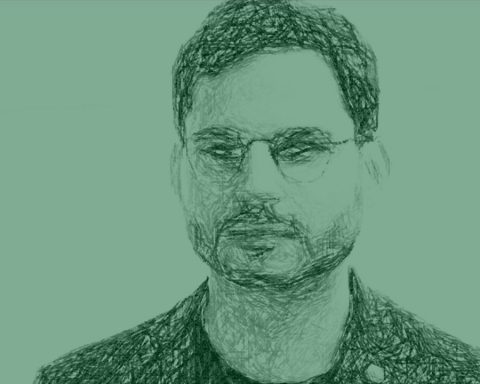


pathetisch-eindruckschindend… echt jetzt?