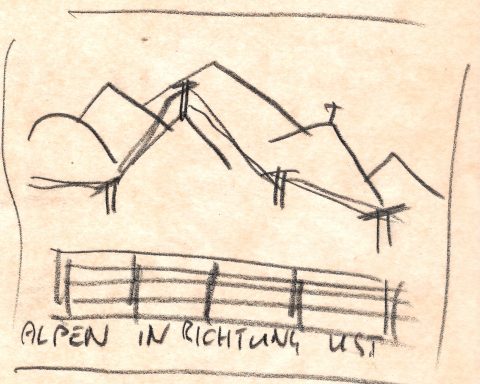Wie heißt das mit Abstand weltweit größte Studienförderungsprogramm für Frauen? Genau, Miss America. Nein, es ist nicht zu verwechseln mit dem Schönheitswettbewerb, es ist der Schönheitswettbewerb. Zu leicht lässt sich in Zeiten verordneter Frauenquoten universitärer Berufungsverfahren die Tatsache vergessen, dass Quantitäten keineswegs Qualitäten zu sichern pflegen. Es ist eine Sache, dass Frauen akademische Schlüsselstellen zugesprochen bekommen, es ist eine ganz andere, wie sie mit/trotz diesen behandelt werden. Ohne die abgelutschten und durchgekauten Feminismusdiskurse erneut in den Mund zu nehmen, kann dennoch nicht verschwiegen werden, wie der soziale Lebensraum ‚Universität‘ tagtäglich einen Hot Spot für Sexismus darstellt, und das nicht als unbewusstes Nebenprodukt, sondern als gezielter Mechanismus. Frausein im akademischen Raum des 21. Jahrhunderts bleibt ein Negativum des Männlichen. Die universitäre Frau findet sich in einer Dichotomie zwischen vergeilter Männerfantasie und Vermännlichung als alternativlose Option von Gleichstellung. Eine eigene Kultur des Fraulichen wird strategisch nivelliert. Interessanterweise provoziert ein Aufruf zu einer etablierten Eigenart der Weiblichkeit gerade den Protest der FrauenrechtlerInnen, sehen sich diese doch durch eine derartige Forderung dem Ruch der Verniedlichung zu einer rosaroten Barbiewelt ausgesetzt oder in Männerstereotype hinein gezwängt. Übrig bleibt eine nüchterne Feststellung: Die Alleinstellung des ‚anderen Geschlechts‘ jenseits aller Kontraste zum Männlichen wird im universitären Kontext nicht ernst (genug) genommen. Talar, Goldkette und Szepter erzählen weiterhin das Märchen des Penismonopols, wenn auch mit mindestens 50% Strap-Ons unterm Kittel.
Titelbild: (c) pexels